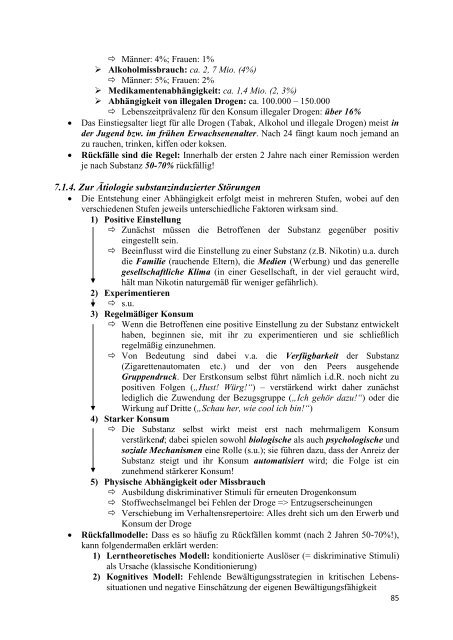KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Männer: 4%; Frauen: 1%<br />
Alkoholmissbrauch: ca. 2, 7 Mio. (4%)<br />
Männer: 5%; Frauen: 2%<br />
Medikamentenabhängigkeit: ca. 1,4 Mio. (2, 3%)<br />
Abhängigkeit von illegalen Drogen: ca. 100.000 – 150.000<br />
Lebenszeitprävalenz für den Konsum illegaler Drogen: über 16%<br />
Das Einstiegsalter liegt für alle Drogen (Tabak, Alkohol und illegale Drogen) meist in<br />
der Jugend bzw. im frühen Erwachsenenalter. Nach 24 fängt kaum noch jemand an<br />
zu rauchen, trinken, kiffen oder koksen.<br />
Rückfälle sind die Regel: Innerhalb der ersten 2 Jahre nach einer Remission werden<br />
je nach Substanz 50-70% rückfällig!<br />
7.1.4. Zur Ätiologie substanzinduzierter Störungen<br />
Die Entstehung einer Abhängigkeit erfolgt meist in mehreren Stufen, wobei auf den<br />
verschiedenen Stufen jeweils unterschiedliche Faktoren wirksam sind.<br />
1) Positive Einstellung<br />
Zunächst müssen die Betroffenen der Substanz gegenüber positiv<br />
eingestellt sein.<br />
Beeinflusst wird die Einstellung zu einer Substanz (z.B. Nikotin) u.a. durch<br />
die Familie (rauchende Eltern), die Medien (Werbung) und das generelle<br />
gesellschaftliche Klima (in einer Gesellschaft, in der viel geraucht wird,<br />
hält man Nikotin naturgemäß für weniger gefährlich).<br />
2) Experimentieren<br />
s.u.<br />
3) Regelmäßiger Konsum<br />
Wenn die Betroffenen eine positive Einstellung zu der Substanz entwickelt<br />
haben, beginnen sie, mit ihr zu experimentieren und sie schließlich<br />
regelmäßig einzunehmen.<br />
Von Bedeutung sind dabei v.a. die Verfügbarkeit der Substanz<br />
(Zigarettenautomaten etc.) und der von den Peers ausgehende<br />
<br />
Gruppendruck. Der Erstkonsum selbst führt nämlich i.d.R. noch nicht zu<br />
positiven Folgen („Hust! Würg!“) – verstärkend wirkt daher zunächst<br />
lediglich die Zuwendung der Bezugsgruppe („Ich gehör dazu!“) oder die<br />
Wirkung auf Dritte („Schau her, wie cool ich bin!“)<br />
4) Starker Konsum<br />
Die Substanz selbst wirkt meist erst nach mehrmaligem Konsum<br />
verstärkend; dabei spielen sowohl biologische als auch psychologische und<br />
soziale Mechanismen eine Rolle (s.u.); sie führen dazu, dass der Anreiz der<br />
Substanz steigt und ihr Konsum automatisiert wird; die Folge ist ein<br />
zunehmend stärkerer Konsum!<br />
5) Physische Abhängigkeit oder Missbrauch<br />
Ausbildung diskriminativer Stimuli für erneuten Drogenkonsum<br />
Stoffwechselmangel bei Fehlen der Droge => Entzugserscheinungen<br />
Verschiebung im Verhaltensrepertoire: Alles dreht sich um den Erwerb und<br />
Konsum der Droge<br />
Rückfallmodelle: Dass es so häufig zu Rückfällen kommt (nach 2 Jahren 50-70%!),<br />
kann folgendermaßen erklärt werden:<br />
1) Lerntheoretisches Modell: konditionierte Auslöser (= diskriminative Stimuli)<br />
als Ursache (klassische Konditionierung)<br />
2) Kognitives Modell: Fehlende Bewältigungsstrategien in kritischen Lebenssituationen<br />
und negative Einschätzung der eigenen Bewältigungsfähigkeit<br />
85