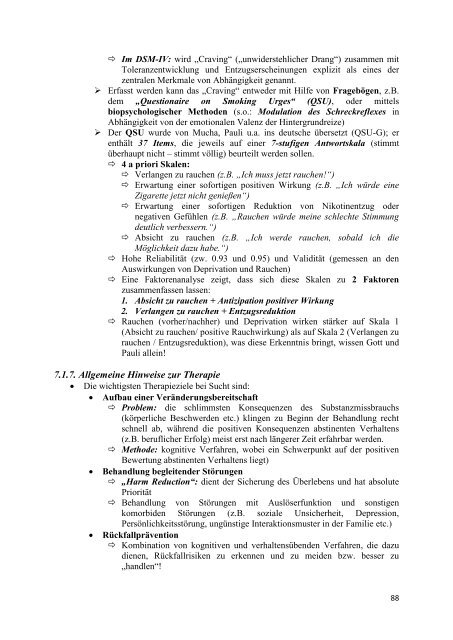KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Im DSM-IV: wird „Craving“ („unwiderstehlicher Drang“) zusammen mit<br />
Toleranzentwicklung und Entzugserscheinungen explizit als eines der<br />
zentralen Merkmale von Abhängigkeit genannt.<br />
Erfasst werden kann das „Craving“ entweder mit Hilfe von Fragebögen, z.B.<br />
dem „Questionaire on Smoking Urges“ (QSU), oder mittels<br />
biopsychologischer Methoden (s.o.: Modulation des Schreckreflexes in<br />
Abhängigkeit von der emotionalen Valenz der Hintergrundreize)<br />
Der QSU wurde von Mucha, Pauli u.a. ins deutsche übersetzt (QSU-G); er<br />
enthält 37 Items, die jeweils auf einer 7-stufigen Antwortskala (stimmt<br />
überhaupt nicht – stimmt völlig) beurteilt werden sollen.<br />
4 a priori Skalen:<br />
Verlangen zu rauchen (z.B. „Ich muss jetzt rauchen!“)<br />
Erwartung einer sofortigen positiven Wirkung (z.B. „Ich würde eine<br />
Zigarette jetzt nicht genießen“)<br />
Erwartung einer sofortigen Reduktion von Nikotinentzug oder<br />
negativen Gefühlen (z.B. „Rauchen würde meine schlechte Stimmung<br />
deutlich verbessern.“)<br />
Absicht zu rauchen (z.B. „Ich werde rauchen, sobald ich die<br />
Möglichkeit dazu habe.“)<br />
Hohe Reliabilität (zw. 0.93 und 0.95) und Validität (gemessen an den<br />
Auswirkungen von Deprivation und Rauchen)<br />
Eine Faktorenanalyse zeigt, dass sich diese Skalen zu 2 Faktoren<br />
zusammenfassen lassen:<br />
1. Absicht zu rauchen + Antizipation positiver Wirkung<br />
2. Verlangen zu rauchen + Entzugsreduktion<br />
Rauchen (vorher/nachher) und Deprivation wirken stärker auf Skala 1<br />
(Absicht zu rauchen/ positive Rauchwirkung) als auf Skala 2 (Verlangen zu<br />
rauchen / Entzugsreduktion), was diese Erkenntnis bringt, wissen Gott und<br />
Pauli allein!<br />
7.1.7. Allgemeine Hinweise zur Therapie<br />
Die wichtigsten Therapieziele bei Sucht sind:<br />
Aufbau einer Veränderungsbereitschaft<br />
Problem: die schlimmsten Konsequenzen des Substanzmissbrauchs<br />
(körperliche Beschwerden etc.) klingen zu Beginn der Behandlung recht<br />
schnell ab, während die positiven Konsequenzen abstinenten Verhaltens<br />
(z.B. beruflicher Erfolg) meist erst nach längerer Zeit erfahrbar werden.<br />
Methode: kognitive Verfahren, wobei ein Schwerpunkt auf der positiven<br />
Bewertung abstinenten Verhaltens liegt)<br />
Behandlung begleitender Störungen<br />
„Harm Reduction“: dient der Sicherung des Überlebens und hat absolute<br />
Priorität<br />
Behandlung von Störungen mit Auslöserfunktion und sonstigen<br />
komorbiden Störungen (z.B. soziale Unsicherheit, Depression,<br />
Persönlichkeitsstörung, ungünstige Interaktionsmuster in der Familie etc.)<br />
Rückfallprävention<br />
Kombination von kognitiven und verhaltensübenden Verfahren, die dazu<br />
dienen, Rückfallrisiken zu erkennen und zu meiden bzw. besser zu<br />
„handlen“!<br />
88