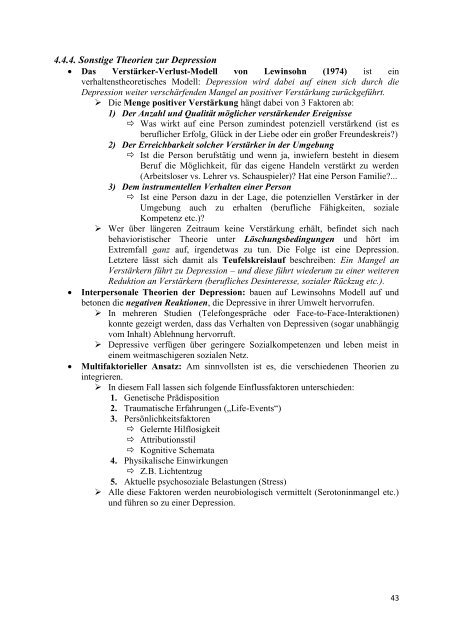KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4.4.4. Sonstige Theorien zur Depression<br />
Das Verstärker-Verlust-Modell von Lewinsohn (1974) ist ein<br />
verhaltenstheoretisches Modell: Depression wird dabei auf einen sich durch die<br />
Depression weiter verschärfenden Mangel an positiver Verstärkung zurückgeführt.<br />
Die Menge positiver Verstärkung hängt dabei von 3 Faktoren ab:<br />
1) Der Anzahl und Qualität möglicher verstärkender Ereignisse<br />
Was wirkt auf eine Person zumindest potenziell verstärkend (ist es<br />
beruflicher Erfolg, Glück in der Liebe oder ein großer Freundeskreis?)<br />
2) Der Erreichbarkeit solcher Verstärker in der Umgebung<br />
Ist die Person berufstätig und wenn ja, inwiefern besteht in diesem<br />
Beruf die Möglichkeit, für das eigene Handeln verstärkt zu werden<br />
(Arbeitsloser vs. Lehrer vs. Schauspieler)? Hat eine Person Familie?...<br />
3) Dem instrumentellen Verhalten einer Person<br />
Ist eine Person dazu in der Lage, die potenziellen Verstärker in der<br />
Umgebung auch zu erhalten (berufliche Fähigkeiten, soziale<br />
Kompetenz etc.)?<br />
Wer über längeren Zeitraum keine Verstärkung erhält, befindet sich nach<br />
behavioristischer Theorie unter Löschungsbedingungen und hört im<br />
Extremfall ganz auf, irgendetwas zu tun. Die Folge ist eine Depression.<br />
Letztere lässt sich damit als Teufelskreislauf beschreiben: Ein Mangel an<br />
Verstärkern führt zu Depression – und diese führt wiederum zu einer weiteren<br />
Reduktion an Verstärkern (berufliches Desinteresse, sozialer Rückzug etc.).<br />
Interpersonale Theorien der Depression: bauen auf Lewinsohns Modell auf und<br />
betonen die negativen Reaktionen, die Depressive in ihrer Umwelt hervorrufen.<br />
In mehreren Studien (Telefongespräche oder Face-to-Face-Interaktionen)<br />
konnte gezeigt werden, dass das Verhalten von Depressiven (sogar unabhängig<br />
vom Inhalt) Ablehnung hervorruft.<br />
Depressive verfügen über geringere Sozialkompetenzen und leben meist in<br />
einem weitmaschigeren sozialen Netz.<br />
Multifaktorieller Ansatz: Am sinnvollsten ist es, die verschiedenen Theorien zu<br />
integrieren.<br />
In diesem Fall lassen sich folgende Einflussfaktoren unterschieden:<br />
1. Genetische Prädisposition<br />
2. Traumatische Erfahrungen („Life-Events“)<br />
3. Persönlichkeitsfaktoren<br />
Gelernte Hilflosigkeit<br />
Attributionsstil<br />
Kognitive Schemata<br />
4. Physikalische Einwirkungen<br />
Z.B. Lichtentzug<br />
5. Aktuelle psychosoziale Belastungen (Stress)<br />
Alle diese Faktoren werden neurobiologisch vermittelt (Serotoninmangel etc.)<br />
und führen so zu einer Depression.<br />
43