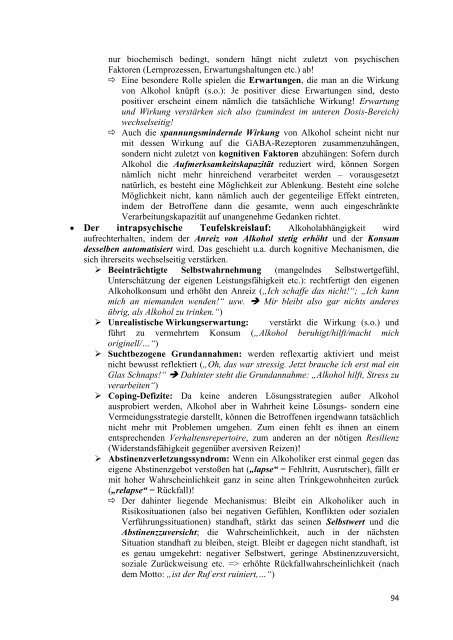KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nur biochemisch bedingt, sondern hängt nicht zuletzt von psychischen<br />
Faktoren (Lernprozessen, Erwartungshaltungen etc.) ab!<br />
Eine besondere Rolle spielen die Erwartungen, die man an die Wirkung<br />
von Alkohol knüpft (s.o.): Je positiver diese Erwartungen sind, desto<br />
positiver erscheint einem nämlich die tatsächliche Wirkung! Erwartung<br />
und Wirkung verstärken sich also (zumindest im unteren Dosis-Bereich)<br />
wechselseitig!<br />
Auch die spannungsmindernde Wirkung von Alkohol scheint nicht nur<br />
mit dessen Wirkung auf die GABA-Rezeptoren zusammenzuhängen,<br />
sondern nicht zuletzt von kognitiven Faktoren abzuhängen: Sofern durch<br />
Alkohol die Aufmerksamkeitskapazität reduziert wird, können Sorgen<br />
nämlich nicht mehr hinreichend verarbeitet werden – vorausgesetzt<br />
natürlich, es besteht eine Möglichkeit zur Ablenkung. Besteht eine solche<br />
Möglichkeit nicht, kann nämlich auch der gegenteilige Effekt eintreten,<br />
indem der Betroffene dann die gesamte, wenn auch eingeschränkte<br />
Verarbeitungskapazität auf unangenehme Gedanken richtet.<br />
Der intrapsychische Teufelskreislauf: Alkoholabhängigkeit wird<br />
aufrechterhalten, indem der Anreiz von Alkohol stetig erhöht und der Konsum<br />
desselben automatisiert wird. Das geschieht u.a. durch kognitive Mechanismen, die<br />
sich ihrerseits wechselseitig verstärken.<br />
Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung (mangelndes Selbstwertgefühl,<br />
Unterschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit etc.): rechtfertigt den eigenen<br />
Alkoholkonsum und erhöht den Anreiz („Ich schaffe das nicht!“; „Ich kann<br />
mich an niemanden wenden!“ usw. Mir bleibt also gar nichts anderes<br />
übrig, als Alkohol zu trinken.“)<br />
Unrealistische Wirkungserwartung: verstärkt die Wirkung (s.o.) und<br />
führt zu vermehrtem Konsum („Alkohol beruhigt/hilft/macht mich<br />
originell/…“)<br />
Suchtbezogene Grundannahmen: werden reflexartig aktiviert und meist<br />
nicht bewusst reflektiert („Oh, das war stressig. Jetzt brauche ich erst mal ein<br />
Glas Schnaps!“ Dahinter steht die Grundannahme: „Alkohol hilft, Stress zu<br />
verarbeiten“)<br />
Coping-Defizite: Da keine anderen Lösungsstrategien außer Alkohol<br />
ausprobiert werden, Alkohol aber in Wahrheit keine Lösungs- sondern eine<br />
Vermeidungsstrategie darstellt, können die Betroffenen irgendwann tatsächlich<br />
nicht mehr mit Problemen umgehen. Zum einen fehlt es ihnen an einem<br />
entsprechenden Verhaltensrepertoire, zum anderen an der nötigen Resilienz<br />
(Widerstandsfähigkeit gegenüber aversiven Reizen)!<br />
Abstinenzverletzungssyndrom: Wenn ein Alkoholiker erst einmal gegen das<br />
eigene Abstinenzgebot verstoßen hat („lapse“ = Fehltritt, Ausrutscher), fällt er<br />
mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz in seine alten Trinkgewohnheiten zurück<br />
(„relapse“ = Rückfall)!<br />
Der dahinter liegende Mechanismus: Bleibt ein Alkoholiker auch in<br />
Risikosituationen (also bei negativen Gefühlen, Konflikten oder sozialen<br />
Verführungssituationen) standhaft, stärkt das seinen Selbstwert und die<br />
Abstinenzzuversicht; die Wahrscheinlichkeit, auch in der nächsten<br />
Situation standhaft zu bleiben, steigt. Bleibt er dagegen nicht standhaft, ist<br />
es genau umgekehrt: negativer Selbstwert, geringe Abstinenzzuversicht,<br />
soziale Zurückweisung etc. => erhöhte Rückfallwahrscheinlichkeit (nach<br />
dem Motto: „ist der Ruf erst ruiniert,…“)<br />
94