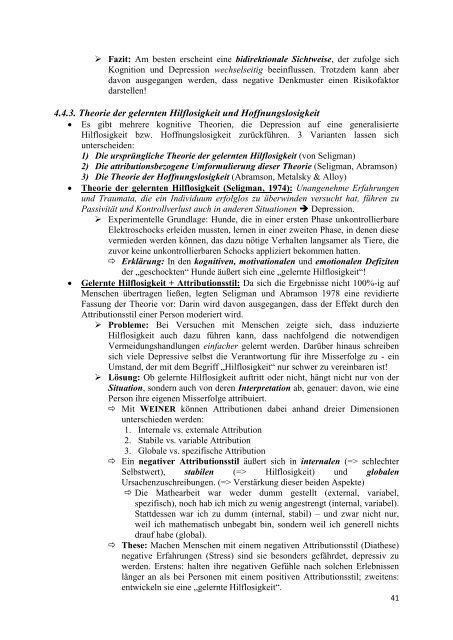KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fazit: Am besten erscheint eine bidirektionale Sichtweise, der zufolge sich<br />
Kognition und Depression wechselseitig beeinflussen. Trotzdem kann aber<br />
davon ausgegangen werden, dass negative Denkmuster einen Risikofaktor<br />
darstellen!<br />
4.4.3. Theorie der gelernten Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit<br />
Es gibt mehrere kognitive Theorien, die Depression auf eine generalisierte<br />
Hilflosigkeit bzw. Hoffnungslosigkeit zurückführen. 3 Varianten lassen sich<br />
unterscheiden:<br />
1) Die ursprüngliche Theorie der gelernten Hilflosigkeit (von Seligman)<br />
2) Die attributionsbezogene Umformulierung dieser Theorie (Seligman, Abramson)<br />
3) Die Theorie der Hoffnungslosigkeit (Abramson, Metalsky & Alloy)<br />
Theorie der gelernten Hilflosigkeit (Seligman, 1974): Unangenehme Erfahrungen<br />
und Traumata, die ein Individuum erfolglos zu überwinden versucht hat, führen zu<br />
Passivität und Kontrollverlust auch in anderen Situationen Depression.<br />
Experimentelle Grundlage: Hunde, die in einer ersten Phase unkontrollierbare<br />
Elektroschocks erleiden mussten, lernen in einer zweiten Phase, in denen diese<br />
vermieden werden können, das dazu nötige Verhalten langsamer als Tiere, die<br />
zuvor keine unkontrollierbaren Schocks appliziert bekommen hatten.<br />
Erklärung: In den kognitiven, motivationalen und emotionalen Defiziten<br />
der „geschockten“ Hunde äußert sich eine „gelernte Hilflosigkeit“!<br />
Gelernte Hilflosigkeit + Attributionsstil: Da sich die Ergebnisse nicht 100%-ig auf<br />
Menschen übertragen ließen, legten Seligman und Abramson 1978 eine revidierte<br />
Fassung der Theorie vor: Darin wird davon ausgegangen, dass der Effekt durch den<br />
Attributionsstil einer Person moderiert wird.<br />
Probleme: Bei Versuchen mit Menschen zeigte sich, dass induzierte<br />
Hilflosigkeit auch dazu führen kann, dass nachfolgend die notwendigen<br />
Vermeidungshandlungen einfacher gelernt werden. Darüber hinaus schreiben<br />
sich viele Depressive selbst die Verantwortung für ihre Misserfolge zu - ein<br />
Umstand, der mit dem Begriff „Hilflosigkeit“ nur schwer zu vereinbaren ist!<br />
Lösung: Ob gelernte Hilflosigkeit auftritt oder nicht, hängt nicht nur von der<br />
Situation, sondern auch von deren Interpretation ab, genauer: davon, wie eine<br />
Person ihre eigenen Misserfolge attribuiert.<br />
Mit WEINER können Attributionen dabei anhand dreier Dimensionen<br />
unterschieden werden:<br />
1. Internale vs. externale Attribution<br />
2. Stabile vs. variable Attribution<br />
3. Globale vs. spezifische Attribution<br />
Ein negativer Attributionsstil äußert sich in internalen (=> schlechter<br />
Selbstwert), stabilen (=> Hilflosigkeit) und globalen<br />
Ursachenzuschreibungen. (=> Verstärkung dieser beiden Aspekte)<br />
Die Mathearbeit war weder dumm gestellt (external, variabel,<br />
spezifisch), noch hab ich mich zu wenig angestrengt (internal, variabel).<br />
Stattdessen war ich zu dumm (internal, stabil) – und zwar nicht nur,<br />
weil ich mathematisch unbegabt bin, sondern weil ich generell nichts<br />
drauf habe (global).<br />
These: Machen Menschen mit einem negativen Attributionsstil (Diathese)<br />
negative Erfahrungen (Stress) sind sie besonders gefährdet, depressiv zu<br />
werden. Erstens: halten ihre negativen Gefühle nach solchen Erlebnissen<br />
länger an als bei Personen mit einem positiven Attributionsstil; zweitens:<br />
entwickeln sie eine „gelernte Hilflosigkeit“.<br />
41