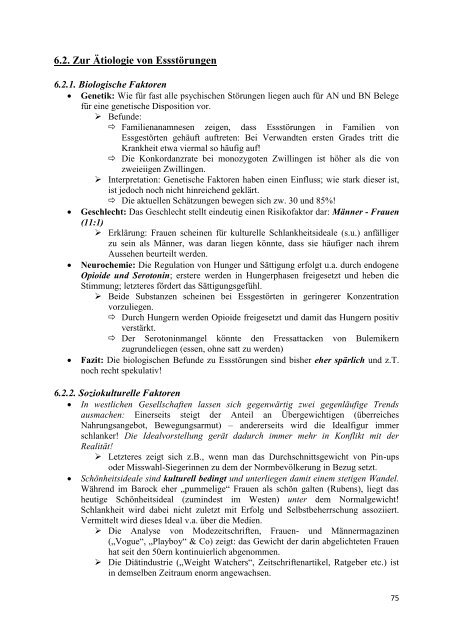KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6.2. Zur Ätiologie von Essstörungen<br />
6.2.1. Biologische Faktoren<br />
Genetik: Wie für fast alle psychischen Störungen liegen auch für AN und BN Belege<br />
für eine genetische Disposition vor.<br />
Befunde:<br />
Familienanamnesen zeigen, dass Essstörungen in Familien von<br />
Essgestörten gehäuft auftreten: Bei Verwandten ersten Grades tritt die<br />
Krankheit etwa viermal so häufig auf!<br />
Die Konkordanzrate bei monozygoten Zwillingen ist höher als die von<br />
zweieiigen Zwillingen.<br />
Interpretation: Genetische Faktoren haben einen Einfluss; wie stark dieser ist,<br />
ist jedoch noch nicht hinreichend geklärt.<br />
Die aktuellen Schätzungen bewegen sich zw. 30 und 85%!<br />
Geschlecht: Das Geschlecht stellt eindeutig einen Risikofaktor dar: Männer - Frauen<br />
(11:1)<br />
Erklärung: Frauen scheinen für kulturelle Schlankheitsideale (s.u.) anfälliger<br />
zu sein als Männer, was daran liegen könnte, dass sie häufiger nach ihrem<br />
Aussehen beurteilt werden.<br />
Neurochemie: Die Regulation von Hunger und Sättigung erfolgt u.a. durch endogene<br />
Opioide und Serotonin; erstere werden in Hungerphasen freigesetzt und heben die<br />
Stimmung; letzteres fördert das Sättigungsgefühl.<br />
Beide Substanzen scheinen bei Essgestörten in geringerer Konzentration<br />
vorzuliegen.<br />
Durch Hungern werden Opioide freigesetzt und damit das Hungern positiv<br />
verstärkt.<br />
Der Serotoninmangel könnte den Fressattacken von Bulemikern<br />
zugrundeliegen (essen, ohne satt zu werden)<br />
Fazit: Die biologischen Befunde zu Essstörungen sind bisher eher spärlich und z.T.<br />
noch recht spekulativ!<br />
6.2.2. Soziokulturelle Faktoren<br />
In westlichen Gesellschaften lassen sich gegenwärtig zwei gegenläufige Trends<br />
ausmachen: Einerseits steigt der Anteil an Übergewichtigen (überreiches<br />
Nahrungsangebot, Bewegungsarmut) – andererseits wird die Idealfigur immer<br />
schlanker! Die Idealvorstellung gerät dadurch immer mehr in Konflikt mit der<br />
Realität!<br />
Letzteres zeigt sich z.B., wenn man das Durchschnittsgewicht von Pin-ups<br />
oder Misswahl-Siegerinnen zu dem der Normbevölkerung in Bezug setzt.<br />
Schönheitsideale sind kulturell bedingt und unterliegen damit einem stetigen Wandel.<br />
Während im Barock eher „pummelige“ Frauen als schön galten (Rubens), liegt das<br />
heutige Schönheitsideal (zumindest im Westen) unter dem Normalgewicht!<br />
Schlankheit wird dabei nicht zuletzt mit Erfolg und Selbstbeherrschung assoziiert.<br />
Vermittelt wird dieses Ideal v.a. über die Medien.<br />
Die Analyse von Modezeitschriften, Frauen- und Männermagazinen<br />
(„Vogue“, „Playboy“ & Co) zeigt: das Gewicht der darin abgelichteten Frauen<br />
hat seit den 50ern kontinuierlich abgenommen.<br />
Die Diätindustrie („Weight Watchers“, Zeitschriftenartikel, Ratgeber etc.) ist<br />
in demselben Zeitraum enorm angewachsen.<br />
75