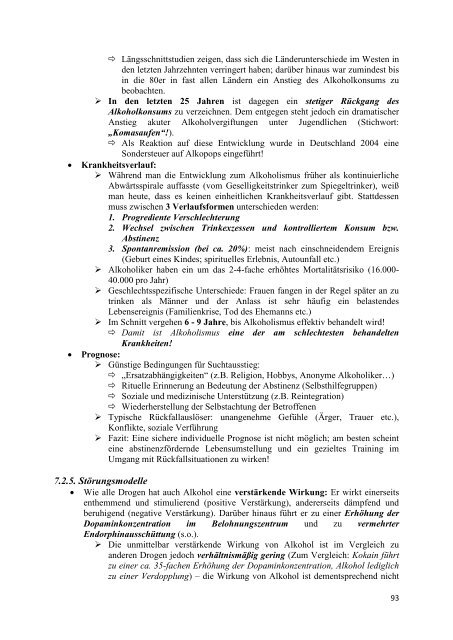KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Längsschnittstudien zeigen, dass sich die Länderunterschiede im Westen in<br />
den letzten Jahrzehnten verringert haben; darüber hinaus war zumindest bis<br />
in die 80er in fast allen Ländern ein Anstieg des Alkoholkonsums zu<br />
beobachten.<br />
In den letzten 25 Jahren ist dagegen ein stetiger Rückgang des<br />
Alkoholkonsums zu verzeichnen. Dem entgegen steht jedoch ein dramatischer<br />
Anstieg akuter Alkoholvergiftungen unter Jugendlichen (Stichwort:<br />
„Komasaufen“!).<br />
Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde in Deutschland 2004 eine<br />
Sondersteuer auf Alkopops eingeführt!<br />
Krankheitsverlauf:<br />
Während man die Entwicklung zum Alkoholismus früher als kontinuierliche<br />
Abwärtsspirale auffasste (vom Geselligkeitstrinker zum Spiegeltrinker), weiß<br />
man heute, dass es keinen einheitlichen Krankheitsverlauf gibt. Stattdessen<br />
muss zwischen 3 Verlaufsformen unterschieden werden:<br />
1. Progrediente Verschlechterung<br />
2. Wechsel zwischen Trinkexzessen und kontrolliertem Konsum bzw.<br />
Abstinenz<br />
3. Spontanremission (bei ca. 20%): meist nach einschneidendem Ereignis<br />
(Geburt eines Kindes; spirituelles Erlebnis, Autounfall etc.)<br />
Alkoholiker haben ein um das 2-4-fache erhöhtes Mortalitätsrisiko (16.000-<br />
40.000 pro Jahr)<br />
Geschlechtsspezifische Unterschiede: Frauen fangen in der Regel später an zu<br />
trinken als Männer und der Anlass ist sehr häufig ein belastendes<br />
Lebensereignis (Familienkrise, Tod des Ehemanns etc.)<br />
Im Schnitt vergehen 6 - 9 Jahre, bis Alkoholismus effektiv behandelt wird!<br />
Damit ist Alkoholismus eine der am schlechtesten behandelten<br />
Krankheiten!<br />
Prognose:<br />
Günstige Bedingungen für Suchtausstieg:<br />
„Ersatzabhängigkeiten“ (z.B. Religion, Hobbys, Anonyme Alkoholiker…)<br />
Rituelle Erinnerung an Bedeutung der Abstinenz (Selbsthilfegruppen)<br />
Soziale und medizinische Unterstützung (z.B. Reintegration)<br />
Wiederherstellung der Selbstachtung der Betroffenen<br />
Typische Rückfallauslöser: unangenehme Gefühle (Ärger, Trauer etc.),<br />
Konflikte, soziale Verführung<br />
Fazit: Eine sichere individuelle Prognose ist nicht möglich; am besten scheint<br />
eine abstinenzfördernde Lebensumstellung und ein gezieltes Training im<br />
Umgang mit Rückfallsituationen zu wirken!<br />
7.2.5. Störungsmodelle<br />
Wie alle Drogen hat auch Alkohol eine verstärkende Wirkung: Er wirkt einerseits<br />
enthemmend und stimulierend (positive Verstärkung), andererseits dämpfend und<br />
beruhigend (negative Verstärkung). Darüber hinaus führt er zu einer Erhöhung der<br />
Dopaminkonzentration im Belohnungszentrum und zu vermehrter<br />
Endorphinausschüttung (s.o.).<br />
Die unmittelbar verstärkende Wirkung von Alkohol ist im Vergleich zu<br />
anderen Drogen jedoch verhältnismäßig gering (Zum Vergleich: Kokain führt<br />
zu einer ca. 35-fachen Erhöhung der Dopaminkonzentration, Alkohol lediglich<br />
zu einer Verdopplung) – die Wirkung von Alkohol ist dementsprechend nicht<br />
93