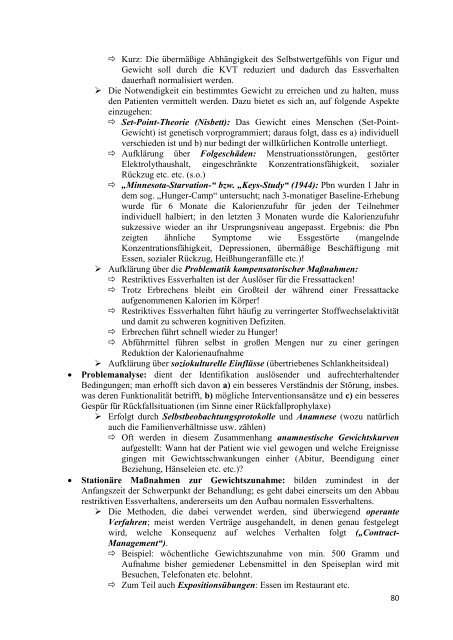KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kurz: Die übermäßige Abhängigkeit des Selbstwertgefühls von Figur und<br />
Gewicht soll durch die KVT reduziert und dadurch das Essverhalten<br />
dauerhaft normalisiert werden.<br />
Die Notwendigkeit ein bestimmtes Gewicht zu erreichen und zu halten, muss<br />
den Patienten vermittelt werden. Dazu bietet es sich an, auf folgende Aspekte<br />
einzugehen:<br />
Set-Point-Theorie (Nisbett): Das Gewicht eines Menschen (Set-Point-<br />
Gewicht) ist genetisch vorprogrammiert; daraus folgt, dass es a) individuell<br />
verschieden ist und b) nur bedingt der willkürlichen Kontrolle unterliegt.<br />
Aufklärung über Folgeschäden: Menstruationsstörungen, gestörter<br />
Elektrolythaushalt, eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, sozialer<br />
Rückzug etc. etc. (s.o.)<br />
„Minnesota-Starvation-“ bzw. „Keys-Study“ (1944): Pbn wurden 1 Jahr in<br />
dem sog. „Hunger-Camp“ untersucht; nach 3-monatiger Baseline-Erhebung<br />
wurde für 6 Monate die Kalorienzufuhr für jeden der Teilnehmer<br />
individuell halbiert; in den letzten 3 Monaten wurde die Kalorienzufuhr<br />
sukzessive wieder an ihr Ursprungsniveau angepasst. Ergebnis: die Pbn<br />
zeigten ähnliche Symptome wie Essgestörte (mangelnde<br />
Konzentrationsfähigkeit, Depressionen, übermäßige Beschäftigung mit<br />
Essen, sozialer Rückzug, Heißhungeranfälle etc.)!<br />
Aufklärung über die Problematik kompensatorischer Maßnahmen:<br />
Restriktives Essverhalten ist der Auslöser für die Fressattacken!<br />
Trotz Erbrechens bleibt ein Großteil der während einer Fressattacke<br />
aufgenommenen Kalorien im Körper!<br />
Restriktives Essverhalten führt häufig zu verringerter Stoffwechselaktivität<br />
und damit zu schweren kognitiven Defiziten.<br />
Erbrechen führt schnell wieder zu Hunger!<br />
Abführmittel führen selbst in großen Mengen nur zu einer geringen<br />
Reduktion der Kalorienaufnahme<br />
Aufklärung über soziokulturelle Einflüsse (übertriebenes Schlankheitsideal)<br />
Problemanalyse: dient der Identifikation auslösender und aufrechterhaltender<br />
Bedingungen; man erhofft sich davon a) ein besseres Verständnis der Störung, insbes.<br />
was deren Funktionalität betrifft, b) mögliche Interventionsansätze und c) ein besseres<br />
Gespür für Rückfallsituationen (im Sinne einer Rückfallprophylaxe)<br />
Erfolgt durch Selbstbeobachtungsprotokolle und Anamnese (wozu natürlich<br />
auch die Familienverhältnisse usw. zählen)<br />
Oft werden in diesem Zusammenhang anamnestische Gewichtskurven<br />
aufgestellt: Wann hat der Patient wie viel gewogen und welche Ereignisse<br />
gingen mit Gewichtsschwankungen einher (Abitur, Beendigung einer<br />
Beziehung, Hänseleien etc. etc.)?<br />
Stationäre Maßnahmen zur Gewichtszunahme: bilden zumindest in der<br />
Anfangszeit der Schwerpunkt der Behandlung; es geht dabei einerseits um den Abbau<br />
restriktiven Essverhaltens, andererseits um den Aufbau normalen Essverhaltens.<br />
Die Methoden, die dabei verwendet werden, sind überwiegend operante<br />
Verfahren; meist werden Verträge ausgehandelt, in denen genau festgelegt<br />
wird, welche Konsequenz auf welches Verhalten folgt („Contract-<br />
Management“).<br />
Beispiel: wöchentliche Gewichtszunahme von min. 500 Gramm und<br />
Aufnahme bisher gemiedener Lebensmittel in den Speiseplan wird mit<br />
Besuchen, Telefonaten etc. belohnt.<br />
Zum Teil auch Expositionsübungen: Essen im Restaurant etc.<br />
80