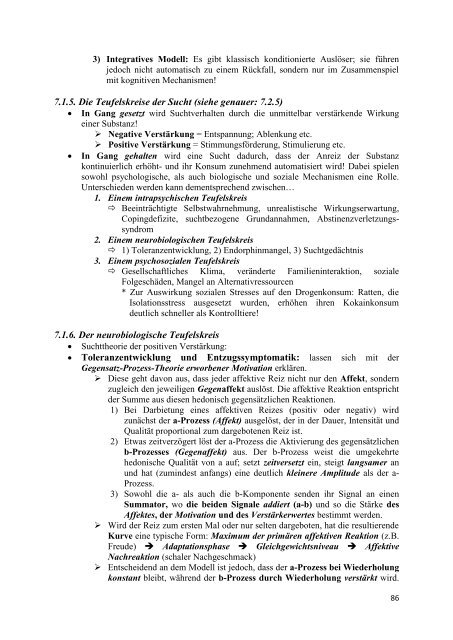KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3) Integratives Modell: Es gibt klassisch konditionierte Auslöser; sie führen<br />
jedoch nicht automatisch zu einem Rückfall, sondern nur im Zusammenspiel<br />
mit kognitiven Mechanismen!<br />
7.1.5. Die Teufelskreise der Sucht (siehe genauer: 7.2.5)<br />
In Gang gesetzt wird Suchtverhalten durch die unmittelbar verstärkende Wirkung<br />
einer Substanz!<br />
Negative Verstärkung = Entspannung; Ablenkung etc.<br />
Positive Verstärkung = Stimmungsförderung, Stimulierung etc.<br />
In Gang gehalten wird eine Sucht dadurch, dass der Anreiz der Substanz<br />
kontinuierlich erhöht- und ihr Konsum zunehmend automatisiert wird! Dabei spielen<br />
sowohl psychologische, als auch biologische und soziale Mechanismen eine Rolle.<br />
Unterschieden werden kann dementsprechend zwischen…<br />
1. Einem intrapsychischen Teufelskreis<br />
Beeinträchtigte Selbstwahrnehmung, unrealistische Wirkungserwartung,<br />
Copingdefizite, suchtbezogene Grundannahmen, Abstinenzverletzungssyndrom<br />
2. Einem neurobiologischen Teufelskreis<br />
1) Toleranzentwicklung, 2) Endorphinmangel, 3) Suchtgedächtnis<br />
3. Einem psychosozialen Teufelskreis<br />
Gesellschaftliches Klima, veränderte Familieninteraktion, soziale<br />
Folgeschäden, Mangel an Alternativressourcen<br />
* Zur Auswirkung sozialen Stresses auf den Drogenkonsum: Ratten, die<br />
Isolationsstress ausgesetzt wurden, erhöhen ihren Kokainkonsum<br />
deutlich schneller als Kontrolltiere!<br />
7.1.6. Der neurobiologische Teufelskreis<br />
Suchttheorie der positiven Verstärkung:<br />
Toleranzentwicklung und Entzugssymptomatik: lassen sich mit der<br />
Gegensatz-Prozess-Theorie erworbener Motivation erklären.<br />
Diese geht davon aus, dass jeder affektive Reiz nicht nur den Affekt, sondern<br />
zugleich den jeweiligen Gegenaffekt auslöst. Die affektive Reaktion entspricht<br />
der Summe aus diesen hedonisch gegensätzlichen Reaktionen.<br />
1) Bei Darbietung eines affektiven Reizes (positiv oder negativ) wird<br />
zunächst der a-Prozess (Affekt) ausgelöst, der in der Dauer, Intensität und<br />
Qualität proportional zum dargebotenen Reiz ist.<br />
2) Etwas zeitverzögert löst der a-Prozess die Aktivierung des gegensätzlichen<br />
b-Prozesses (Gegenaffekt) aus. Der b-Prozess weist die umgekehrte<br />
hedonische Qualität von a auf; setzt zeitversetzt ein, steigt langsamer an<br />
und hat (zumindest anfangs) eine deutlich kleinere Amplitude als der a-<br />
Prozess.<br />
3) Sowohl die a- als auch die b-Komponente senden ihr Signal an einen<br />
Summator, wo die beiden Signale addiert (a-b) und so die Stärke des<br />
Affektes, der Motivation und des Verstärkerwertes bestimmt werden.<br />
Wird der Reiz zum ersten Mal oder nur selten dargeboten, hat die resultierende<br />
Kurve eine typische Form: Maximum der primären affektiven Reaktion (z.B.<br />
Freude) Adaptationsphase Gleichgewichtsniveau Affektive<br />
Nachreaktion (schaler Nachgeschmack)<br />
Entscheidend an dem Modell ist jedoch, dass der a-Prozess bei Wiederholung<br />
konstant bleibt, während der b-Prozess durch Wiederholung verstärkt wird.<br />
86