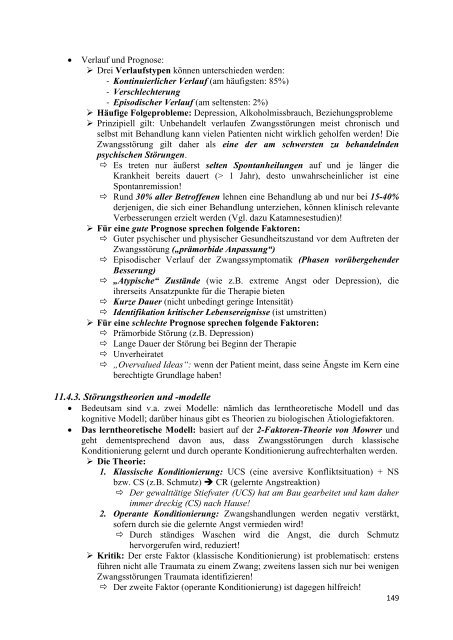KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Verlauf und Prognose:<br />
Drei Verlaufstypen können unterschieden werden:<br />
- Kontinuierlicher Verlauf (am häufigsten: 85%)<br />
- Verschlechterung<br />
- Episodischer Verlauf (am seltensten: 2%)<br />
Häufige Folgeprobleme: Depression, Alkoholmissbrauch, Beziehungsprobleme<br />
Prinzipiell gilt: Unbehandelt verlaufen Zwangsstörungen meist chronisch und<br />
selbst mit Behandlung kann vielen Patienten nicht wirklich geholfen werden! Die<br />
Zwangsstörung gilt daher als eine der am schwersten zu behandelnden<br />
psychischen Störungen.<br />
Es treten nur äußerst selten Spontanheilungen auf und je länger die<br />
Krankheit bereits dauert (> 1 Jahr), desto unwahrscheinlicher ist eine<br />
Spontanremission!<br />
Rund 30% aller Betroffenen lehnen eine Behandlung ab und nur bei 15-40%<br />
derjenigen, die sich einer Behandlung unterziehen, können klinisch relevante<br />
Verbesserungen erzielt werden (Vgl. dazu Katamnesestudien)!<br />
Für eine gute Prognose sprechen folgende Faktoren:<br />
Guter psychischer und physischer Gesundheitszustand vor dem Auftreten der<br />
Zwangsstörung („prämorbide Anpassung“)<br />
Episodischer Verlauf der Zwangssymptomatik (Phasen vorübergehender<br />
Besserung)<br />
„Atypische“ Zustände (wie z.B. extreme Angst oder Depression), die<br />
ihrerseits Ansatzpunkte für die Therapie bieten<br />
Kurze Dauer (nicht unbedingt geringe Intensität)<br />
Identifikation kritischer Lebensereignisse (ist umstritten)<br />
Für eine schlechte Prognose sprechen folgende Faktoren:<br />
Prämorbide Störung (z.B. Depression)<br />
Lange Dauer der Störung bei Beginn der Therapie<br />
Unverheiratet<br />
„Overvalued Ideas“: wenn der Patient meint, dass seine Ängste im Kern eine<br />
berechtigte Grundlage haben!<br />
11.4.3. Störungstheorien und -modelle<br />
Bedeutsam sind v.a. zwei Modelle: nämlich das lerntheoretische Modell und das<br />
kognitive Modell; darüber hinaus gibt es Theorien zu biologischen Ätiologiefaktoren.<br />
Das lerntheoretische Modell: basiert auf der 2-Faktoren-Theorie von Mowrer und<br />
geht dementsprechend davon aus, dass Zwangsstörungen durch klassische<br />
Konditionierung gelernt und durch operante Konditionierung aufrechterhalten werden.<br />
Die Theorie:<br />
1. Klassische Konditionierung: UCS (eine aversive Konfliktsituation) + NS<br />
bzw. CS (z.B. Schmutz) CR (gelernte Angstreaktion)<br />
Der gewalttätige Stiefvater (UCS) hat am Bau gearbeitet und kam daher<br />
immer dreckig (CS) nach Hause!<br />
2. Operante Konditionierung: Zwangshandlungen werden negativ verstärkt,<br />
sofern durch sie die gelernte Angst vermieden wird!<br />
Durch ständiges Waschen wird die Angst, die durch Schmutz<br />
hervorgerufen wird, reduziert!<br />
Kritik: Der erste Faktor (klassische Konditionierung) ist problematisch: erstens<br />
führen nicht alle Traumata zu einem Zwang; zweitens lassen sich nur bei wenigen<br />
Zwangsstörungen Traumata identifizieren!<br />
Der zweite Faktor (operante Konditionierung) ist dagegen hilfreich!<br />
149