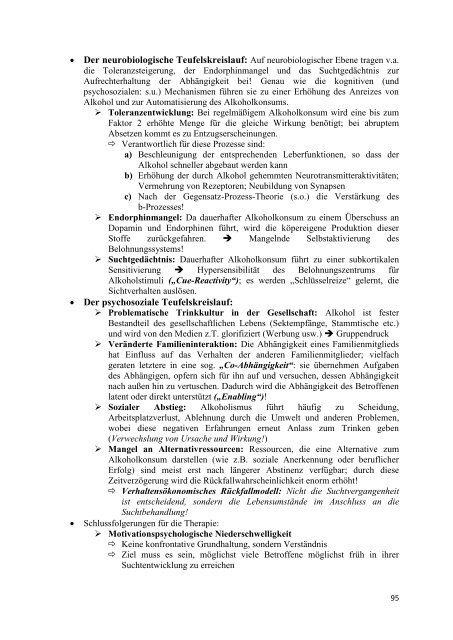KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Der neurobiologische Teufelskreislauf: Auf neurobiologischer Ebene tragen v.a.<br />
die Toleranzsteigerung, der Endorphinmangel und das Suchtgedächtnis zur<br />
Aufrechterhaltung der Abhängigkeit bei! Genau wie die kognitiven (und<br />
psychosozialen: s.u.) Mechanismen führen sie zu einer Erhöhung des Anreizes von<br />
Alkohol und zur Automatisierung des Alkoholkonsums.<br />
Toleranzentwicklung: Bei regelmäßigem Alkoholkonsum wird eine bis zum<br />
Faktor 2 erhöhte Menge für die gleiche Wirkung benötigt; bei abruptem<br />
Absetzen kommt es zu Entzugserscheinungen.<br />
Verantwortlich für diese Prozesse sind:<br />
a) Beschleunigung der entsprechenden Leberfunktionen, so dass der<br />
Alkohol schneller abgebaut werden kann<br />
b) Erhöhung der durch Alkohol gehemmten Neurotransmitteraktivitäten;<br />
Vermehrung von Rezeptoren; Neubildung von Synapsen<br />
c) Nach der Gegensatz-Prozess-Theorie (s.o.) die Verstärkung des<br />
b-Prozesses!<br />
Endorphinmangel: Da dauerhafter Alkoholkonsum zu einem Überschuss an<br />
Dopamin und Endorphinen führt, wird die köpereigene Produktion dieser<br />
Stoffe zurückgefahren. Mangelnde Selbstaktivierung des<br />
Belohnungssystems!<br />
Suchtgedächtnis: Dauerhafter Alkoholkonsum führt zu einer subkortikalen<br />
Sensitivierung Hypersensibilität des Belohnungszentrums für<br />
Alkoholstimuli („Cue-Reactivity“); es werden „Schlüsselreize“ gelernt, die<br />
Sichtverhalten auslösen.<br />
Der psychosoziale Teufelskreislauf:<br />
Problematische Trinkkultur in der Gesellschaft: Alkohol ist fester<br />
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens (Sektempfänge, Stammtische etc.)<br />
und wird von den Medien z.T. glorifiziert (Werbung usw.) Gruppendruck<br />
Veränderte Familieninteraktion: Die Abhängigkeit eines Familienmitglieds<br />
hat Einfluss auf das Verhalten der anderen Familienmitglieder; vielfach<br />
geraten letztere in eine sog. „Co-Abhängigkeit“: sie übernehmen Aufgaben<br />
des Abhängigen, opfern sich für ihn auf und versuchen, dessen Abhängigkeit<br />
nach außen hin zu vertuschen. Dadurch wird die Abhängigkeit des Betroffenen<br />
latent oder direkt unterstützt („Enabling“)!<br />
Sozialer Abstieg: Alkoholismus führt häufig zu Scheidung,<br />
Arbeitsplatzverlust, Ablehnung durch die Umwelt und anderen Problemen,<br />
wobei diese negativen Erfahrungen erneut Anlass zum Trinken geben<br />
(Verwechslung von Ursache und Wirkung!)<br />
Mangel an Alternativressourcen: Ressourcen, die eine Alternative zum<br />
Alkoholkonsum darstellen (wie z.B. soziale Anerkennung oder beruflicher<br />
Erfolg) sind meist erst nach längerer Abstinenz verfügbar; durch diese<br />
Zeitverzögerung wird die Rückfallwahrscheinlichkeit enorm erhöht!<br />
Verhaltensökonomisches Rückfallmodell: Nicht die Suchtvergangenheit<br />
ist entscheidend, sondern die Lebensumstände im Anschluss an die<br />
Suchtbehandlung!<br />
Schlussfolgerungen für die Therapie:<br />
Motivationspsychologische Niederschwelligkeit<br />
Keine konfrontative Grundhaltung, sondern Verständnis<br />
Ziel muss es sein, möglichst viele Betroffene möglichst früh in ihrer<br />
Suchtentwicklung zu erreichen<br />
95