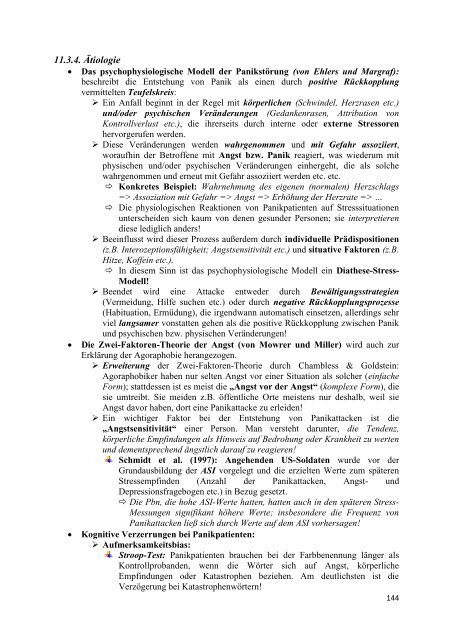KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
KLINISCHE PSYCHOLOGIE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
11.3.4. Ätiologie<br />
Das psychophysiologische Modell der Panikstörung (von Ehlers und Margraf):<br />
beschreibt die Entstehung von Panik als einen durch positive Rückkopplung<br />
vermittelten Teufelskreis:<br />
Ein Anfall beginnt in der Regel mit körperlichen (Schwindel, Herzrasen etc.)<br />
und/oder psychischen Veränderungen (Gedankenrasen, Attribution von<br />
Kontrollverlust etc.), die ihrerseits durch interne oder externe Stressoren<br />
hervorgerufen werden.<br />
Diese Veränderungen werden wahrgenommen und mit Gefahr assoziiert,<br />
woraufhin der Betroffene mit Angst bzw. Panik reagiert, was wiederum mit<br />
physischen und/oder psychischen Veränderungen einhergeht, die als solche<br />
wahrgenommen und erneut mit Gefahr assoziiert werden etc. etc.<br />
Konkretes Beispiel: Wahrnehmung des eigenen (normalen) Herzschlags<br />
=> Assoziation mit Gefahr => Angst => Erhöhung der Herzrate => …<br />
Die physiologischen Reaktionen von Panikpatienten auf Stresssituationen<br />
unterscheiden sich kaum von denen gesunder Personen; sie interpretieren<br />
diese lediglich anders!<br />
Beeinflusst wird dieser Prozess außerdem durch individuelle Prädispositionen<br />
(z.B. Interozeptionsfähigkeit; Angstsensitivität etc.) und situative Faktoren (z.B.<br />
Hitze, Koffein etc.).<br />
In diesem Sinn ist das psychophysiologische Modell ein Diathese-Stress-<br />
Modell!<br />
Beendet wird eine Attacke entweder durch Bewältigungsstrategien<br />
<br />
(Vermeidung, Hilfe suchen etc.) oder durch negative Rückkopplungsprozesse<br />
(Habituation, Ermüdung), die irgendwann automatisch einsetzen, allerdings sehr<br />
viel langsamer vonstatten gehen als die positive Rückkopplung zwischen Panik<br />
und psychischen bzw. physischen Veränderungen!<br />
Die Zwei-Faktoren-Theorie der Angst (von Mowrer und Miller) wird auch zur<br />
Erklärung der Agoraphobie herangezogen.<br />
Erweiterung der Zwei-Faktoren-Theorie durch Chambless & Goldstein:<br />
Agoraphobiker haben nur selten Angst vor einer Situation als solcher (einfache<br />
Form); stattdessen ist es meist die „Angst vor der Angst“ (komplexe Form), die<br />
sie umtreibt. Sie meiden z.B. öffentliche Orte meistens nur deshalb, weil sie<br />
Angst davor haben, dort eine Panikattacke zu erleiden!<br />
Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von Panikattacken ist die<br />
„Angstsensitivität“ einer Person. Man versteht darunter, die Tendenz,<br />
körperliche Empfindungen als Hinweis auf Bedrohung oder Krankheit zu werten<br />
und dementsprechend ängstlich darauf zu reagieren!<br />
Schmidt et al. (1997): Angehenden US-Soldaten wurde vor der<br />
Grundausbildung der ASI vorgelegt und die erzielten Werte zum späteren<br />
Stressempfinden (Anzahl der Panikattacken, Angst- und<br />
<br />
Depressionsfragebogen etc.) in Bezug gesetzt.<br />
Die Pbn, die hohe ASI-Werte hatten, hatten auch in den späteren Stress-<br />
Messungen signifikant höhere Werte; insbesondere die Frequenz von<br />
Panikattacken ließ sich durch Werte auf dem ASI vorhersagen!<br />
Kognitive Verzerrungen bei Panikpatienten:<br />
Aufmerksamkeitsbias:<br />
Stroop-Test: Panikpatienten brauchen bei der Farbbenennung länger als<br />
Kontrollprobanden, wenn die Wörter sich auf Angst, körperliche<br />
Empfindungen oder Katastrophen beziehen. Am deutlichsten ist die<br />
Verzögerung bei Katastrophenwörtern!<br />
144