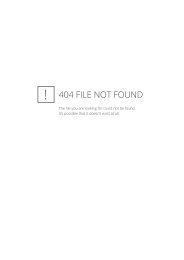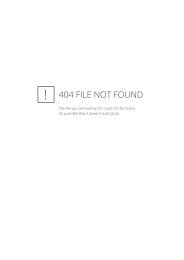33. Sitzung - Deutscher Bundestag
33. Sitzung - Deutscher Bundestag
33. Sitzung - Deutscher Bundestag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2636 <strong>Deutscher</strong> <strong>Bundestag</strong> — 12. Wahlperiode — <strong>33.</strong> <strong>Sitzung</strong>. Bonn, Mittwoch, den 19. Juni 1991<br />
Dr. Gero Pfennig<br />
beitung von Petitionen, die Bund und Länder gleichzeitig<br />
betreffen, austauschen konnten.<br />
Allen Mitgliedern des Ausschusses möchte ich herzlich<br />
danken. Sie müssen nicht nur den Eingabenzuwachs<br />
bewältigen, sie sind durch Tätigkeit im Petitionsausschuß<br />
und der Mitgliedschaft in den Fachausschüssen<br />
auch einer Doppelbelastung ausgesetzt. Der<br />
gleiche Dank gilt den Mitarbeitern des Petitionsausschusses,<br />
die, wie ich es dargestellt habe, eine enorme<br />
Mehrarbeit schon im Jahre 1990 und fortgesetzt jetzt<br />
auch 1991 bewältigen müssen.<br />
Allen Bürgern, die sich mit ihren Sorgen an den<br />
Petitionsausschuß gewandt haben, darf ich versichern,<br />
daß der Ausschuß in seinem Bemühen nicht<br />
nachlassen wird, berechtigte Interessen engagiert zu<br />
vertreten.<br />
(Beifall im ganzen Hause)<br />
Vizepräsidentin Renate Schmidt: Das Wort hat der<br />
Kollege Horst Peter.<br />
Horst Peter (Kassel) (SPD): Frau Präsidentin! Meine<br />
Damen und Herren! Wir beraten heute über den letzten<br />
Jahresbericht des Petitionsausschusses der vergangenen<br />
Legislaturperiode, deshalb ein knapper<br />
Rückblick auf die vergangene Legislaturperiode. Wir<br />
hatten in den Debatten der letzten Jahresberichte drei<br />
Streitpunkte: Erstens. Gibt es einen Unterschied zwischen<br />
politischen Petitionen und p rivaten Anliegen?<br />
Zweitens. Gibt es die Notwendigkeit, Massenpetitionen<br />
anders als Einzelpetitionen zu behandeln? Drittens.<br />
Ist der Petitionsausschuß ein Überausschuß, der<br />
auch fachpolitische Problemstellungen zu entscheiden<br />
hat?<br />
Inzwischen bin ich der Auffassung, daß sich diese<br />
Streitpunkte im Lichte unserer neuen Grundsätze als<br />
scheinbare Streitpunkte erwiesen haben. Ich bin nun<br />
wirklich kein Feind von Konfrontation,<br />
(Zuruf des Abg. Bernd Reuter (SPD])<br />
— ich gehe keinem Streit aus dem Wege, kann man<br />
auch sagen —, aber die neuen Grundsätze haben die<br />
richtige Konfliktlinie dargestellt. Wir sind im Petitionsausschuß<br />
über die Behandlung von Verfahren<br />
weitgehend einig und können uns dann oft gemeinsam<br />
an der Verwaltung, an der Bundesregierung, am<br />
Arbeitsamt, an der Krankenversicherung usw. abarbeiten,<br />
und das ist, glaube ich, die richtige Zielstellung<br />
im Interesse der Petenten.<br />
Die Ursache dafür sind unsere Verfahrensgrundsätze.<br />
Wir haben uns Mühe gegeben, die Voten differenzierter<br />
zu gestalten. So ist es möglich, die Unterschiede<br />
zwischen politischen und p rivaten Anliegen,<br />
zwischen Einzel- und Massenpetitionen und auch die<br />
Frage, ob der Petitionsausschuß ein übergreifender<br />
Ausschuß ist, auszugleichen. Wir haben uns mit den<br />
neuen Grundsätzen auch die Möglichkeit eröffnet,<br />
den Bundesrechnungshof einzuschalten, wenn es uns<br />
sinnvoll erscheint, das Bundesversicherungsamt einzuschalten,<br />
um in dem Bereich, in dem wir oft machtlos<br />
sind — bei Verhaltensweisen der Sozialversicherungen<br />
—, einen Zugriff zu erhalten. Wir haben ja das<br />
Problem, daß unser Zugriff im Sozialversicherungsbereich<br />
durch die Aufgabe, die die Selbstverwaltung<br />
wahrnimmt, gebremst ist. Ich werde im Laufe dieses<br />
Beitrags verdeutlichen, daß das für Petenten manchmal<br />
eine sehr schwierige Sache ist.<br />
Wir haben auch die kritische Auseinandersetzung<br />
mit den Stellungnahmen der Regierung auf Berücksichtigungs-<br />
und Erwägungsbeschlüsse zu unserer<br />
ständigen Praxis gemacht. Darauf ist der Vorsitzende<br />
des Ausschusses eingegangen; darauf wird dann mit<br />
weniger Verpflichtung zur Zurückhaltung auch der<br />
Kollege Reuter noch eingehen.<br />
Mir ist aus dem inzwischen klargeworden: Die<br />
Trennung in Petitionen mit privatem oder politischem<br />
Anliegen ist eine Scheinalternative, wenn man<br />
so will: ein antiquierter Streit. Jede Petition hat eine<br />
politische Dimension. Der Unterschied liegt in der<br />
Reichweite des Anliegens.<br />
Beispiel 1: Ein Petent aus Norddeutschland bezog<br />
nach Abschluß seines Studiums von Juli bis Dezember<br />
1989 Arbeitslosenhilfe. Er bewarb sich im gesamten<br />
Bundesgebiet und erhielt im Dezember 1989 eine<br />
mündliche Zusage in Frankfurt am Main. Dort suchte,<br />
fand und renovierte er mit Freunden bis Ende Dezember<br />
eine Wohnung. Seinen schriftlichen Arbeitsvertrag<br />
erhielt er erst am 6. Januar 1990. Am 8. Januar<br />
— die Daten sind wichtig — schrieb er seinem zuständigen<br />
Arbeitsamt, daß er einen Arbeitsvertrag abgeschlossen<br />
habe, der ab dem 1. Januar 1990 gelte und<br />
den er seit dem 2. Januar 1990 erfülle. Des weiteren<br />
fragte er nach Rückzahlungsmodalitäten für eventuell<br />
zuviel erhaltene Arbeitslosenhilfe. Außerdem bat er<br />
um Informationen über Beihilfe zu seinen Umzugskosten.<br />
Am 25. Januar teilte ihm das Arbeitsamt mit, daß<br />
sein Antrag auf Gewährung von Umzugskosten verspätet<br />
erfolgt sei — spätestens bis zum Tag der Arbeitsaufnahme<br />
oder am Tag des Umzugs —, und<br />
übersandte als Beleg nunmehr das entsprechende<br />
Merkblatt.<br />
Mit Schreiben vom 20. Februar erteilte ihm das Arbeitsamt<br />
darüber hinaus noch eine förmliche Verwarnung<br />
für seine verspätete Meldung der Arbeitsaufnahme<br />
bezüglich der Zeit vom 2. bis 10. Januar 1990,<br />
sah aber „ausnahmsweise" von einem Verwarnungsgeld<br />
ab.<br />
In der Stellungnahme gegenüber dem Petitionsausschuß<br />
schreibt das Arbeitsamt im Ap ril 1990 zur Begründung<br />
der Ablehnung der Umzugskostenhilfe unter<br />
anderem: „Er hat durch die Durchführung des<br />
Umzugs faktisch bewiesen, daß er auf die Hilfe des<br />
Arbeitsamtes nicht unbedingt angewiesen war." Die<br />
arbeitsverwaltungsbehördliche Posse findet ihren Höhepunkt<br />
in einem Bescheid vom 10. September 1990,<br />
in dem das Arbeitsamt die Arbeitslosenhilfe in Höhe<br />
von 32,10 DM für den 1. Januar 1990 zurückfordert,<br />
da er insoweit die Arbeitsaufnahme nicht richtig mitgeteilt<br />
habe.<br />
Deutlicher als der Petent allerdings in seinem<br />
Schreiben vom 8. Januar 1990 kann man die maßgeblichen<br />
Daten nicht formulieren. Das Arbeitsamt hat<br />
demnach neun Monate später faktisch bewiesen, daß<br />
es der Lektüre einfachster Schreiben nicht unbedingt<br />
gewachsen war. Die Reichweite dieser Petition geht<br />
dahin: Der Arbeitsverwaltung am zuständigen Ort ist