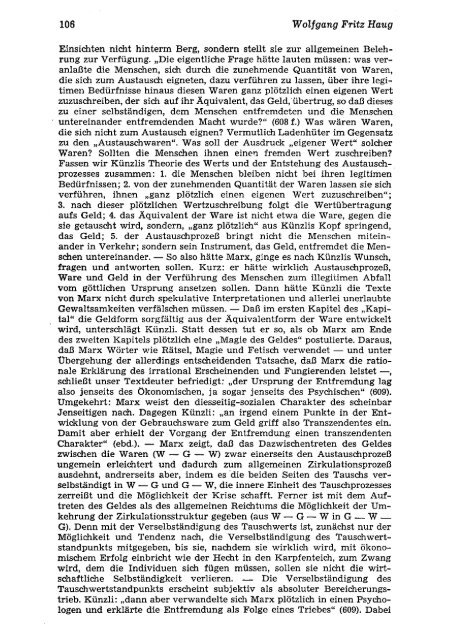Geschichte und Geschichtsschreibung der deutschen ...
Geschichte und Geschichtsschreibung der deutschen ...
Geschichte und Geschichtsschreibung der deutschen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
108<br />
Wolfgang Fritz Haug<br />
Einsichten nicht hinterm Berg, son<strong>der</strong>n stellt sie zur allgemeinen Belehrung<br />
zur Verfügung. „Die eigentliche Frage hätte lauten müssen: was veranlaßte<br />
die Menschen, sich durch die zunehmende Quantität von Waren,<br />
die sich zum Austausch eigneten, dazu verführen zu lassen, über ihre legitimen<br />
Bedürfnisse hinaus diesen Waren ganz plötzlich einen eigenen Wert<br />
zuzuschreiben, <strong>der</strong> sich auf ihr Äquivalent, das Geld, ubertrug, so daß dieses<br />
zu einer selbständigen, dem Menschen entfremdeten <strong>und</strong> die Menschen<br />
untereinan<strong>der</strong> entfremdenden Macht wurde?" (608 f.) Was wären Waren,<br />
die sich nicht zum Austausch eignen? Vermutlich Ladenhüter im Gegensatz<br />
zu den „Austauschwaren". Was soll <strong>der</strong> Ausdruck „eigener Wert" solcher<br />
Waren? Sollten die Menschen ihnen einen fremden Wert zuschreiben?<br />
Fassen wir Künzlis Theorie des Werts <strong>und</strong> <strong>der</strong> Entstehung des Austauschprozesses<br />
zusammen: 1. die Menschen bleiben nicht bei ihren legitimen<br />
Bedürfnissen; 2. von <strong>der</strong> zunehmenden Quantität <strong>der</strong> Waren lassen sie sich<br />
verführen, ihnen „ganz plötzlich einen eigenen Wert zuzuschreiben";<br />
3. nach dieser plötzlichen Wertzuschreibung folgt die Wertübertragung<br />
aufs Geld; 4. das Äquivalent <strong>der</strong> Ware ist nicht etwa die Ware, gegen die<br />
sie getauscht wird, son<strong>der</strong>n, „ganz plötzlich" aus Künzlis Kopf springend,<br />
das Geld; 5. <strong>der</strong> Austauschprozeß bringt nicht die Menschen miteinan<strong>der</strong><br />
in Verkehr; son<strong>der</strong>n sein Instrument, das Geld, entfremdet die Menschen<br />
untereinan<strong>der</strong>. — So also hätte Marx, ginge es nach Künzlis Wunsch,<br />
fragen <strong>und</strong> antworten sollen. Kurz: er hätte wirklich Austauschprozeß,<br />
Ware <strong>und</strong> Geld in <strong>der</strong> Verführung des Menschen zum illegitimen Abfall<br />
vom göttlichen Ursprung ansetzen sollen. Dann hätte Künzli die Texte<br />
von Marx nicht durch spekulative Interpretationen <strong>und</strong> allerlei unerlaubte<br />
Gewaltsamkeiten verfälschen müssen. — Daß im ersten Kapitel des „Kapital"<br />
die Geldform sorgfältig aus <strong>der</strong> Äquivalentform <strong>der</strong> Ware entwickelt<br />
wird, unterschlägt Künzli. Statt dessen tut er so, als ob Marx am Ende<br />
des zweiten Kapitels plötzlich eine „Magie des Geldes" postulierte. Daraus,<br />
daß Marx Wörter wie Rätsel, Magie <strong>und</strong> Fetisch verwendet — <strong>und</strong> unter<br />
Übergehung <strong>der</strong> allerdings entscheidenden Tatsache, daß Marx die rationale<br />
Erklärung des irrational Erscheinenden <strong>und</strong> Fungierenden leistet —,<br />
schließt unser Textdeuter befriedigt: „<strong>der</strong> Ursprung <strong>der</strong> Entfremdung lag<br />
also jenseits des ökonomischen, ja sogar jenseits des Psychischen" (609).<br />
Umgekehrt: Marx weist den diesseitig-sozialen Charakter des scheinbar<br />
Jenseitigen nach. Dagegen Künzli: „an irgend einem Punkte in <strong>der</strong> Entwicklung<br />
von <strong>der</strong> Gebrauchsware zum Geld griff also Transzendentes ein.<br />
Damit aber erhielt <strong>der</strong> Vorgang <strong>der</strong> Entfremdung einen transzendenten<br />
Charakter" (ebd.). — Marx zeigt, daß das Dazwischentreten des Geldes<br />
zwischen die Waren (W — G — W) zwar einerseits den Austauschprozeß<br />
ungemein erleichtert <strong>und</strong> dadurch zum allgemeinen Zirkulationsprozeß<br />
ausdehnt, andrerseits aber, indem es die beiden Seiten des Tauschs verselbständigt<br />
in W — G <strong>und</strong> G — W, die innere Einheit des Tauschprozesses<br />
zerreißt <strong>und</strong> die Möglichkeit <strong>der</strong> Krise schafft. Ferner ist mit dem Auftreten<br />
des Geldes als des allgemeinen Reichtums die Möglichkeit <strong>der</strong> Umkehrung<br />
<strong>der</strong> Zirkulationsstruktur gegeben (aus W — G — WinG — W —<br />
G). Denn mit <strong>der</strong> Verselbständigung des Tauschwerts ist, zunächst nur <strong>der</strong><br />
Möglichkeit <strong>und</strong> Tendenz nach, die Verselbständigung des Tauschwertstandpunkts<br />
mitgegeben, bis sie, nachdem sie wirklich wird, mit ökonomischem<br />
Erfolg einbricht wie <strong>der</strong> Hecht in den Karpfenteich, zum Zwang<br />
wird, dem die Individuen sich fügen müssen, sollen sie nicht die wirtschaftliche<br />
Selbständigkeit verlieren. — Die Verselbständigung des<br />
Tauschwertstandpunkts erscheint subjektiv als absoluter Bereicherungstrieb.<br />
Künzli: „dann aber verwandelte sich Marx plötzlich in einen Psychologen<br />
<strong>und</strong> erklärte die Entfremdung als Folge eines Triebes" (609). Dabei