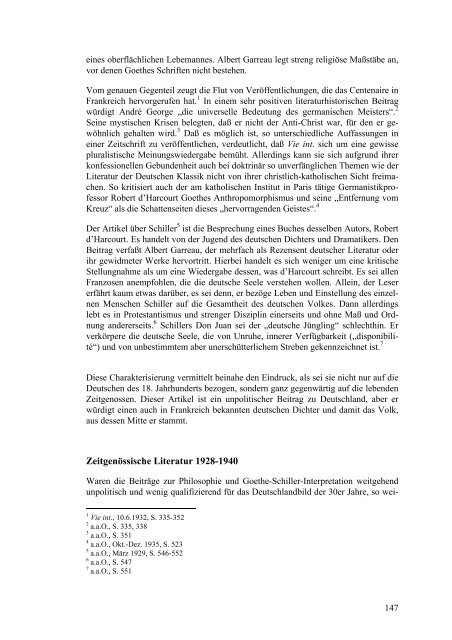Die Deutschlandberichterstattung der Vie Intellectuelle (1928 - 1940 ...
Die Deutschlandberichterstattung der Vie Intellectuelle (1928 - 1940 ...
Die Deutschlandberichterstattung der Vie Intellectuelle (1928 - 1940 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
eines oberflächlichen Lebemannes. Albert Garreau legt streng religiöse Maßstäbe an,<br />
vor denen Goethes Schriften nicht bestehen.<br />
Vom genauen Gegenteil zeugt die Flut von Veröffentlichungen, die das Centenaire in<br />
Frankreich hervorgerufen hat. 1 In einem sehr positiven literaturhistorischen Beitrag<br />
würdigt André George „die universelle Bedeutung des germanischen Meisters“. 2<br />
Seine mystischen Krisen belegten, daß er nicht <strong>der</strong> Anti-Christ war, für den er gewöhnlich<br />
gehalten wird. 3 Daß es möglich ist, so unterschiedliche Auffassungen in<br />
einer Zeitschrift zu veröffentlichen, verdeutlicht, daß <strong>Vie</strong> int. sich um eine gewisse<br />
pluralistische Meinungswie<strong>der</strong>gabe bemüht. Allerdings kann sie sich aufgrund ihrer<br />
konfessionellen Gebundenheit auch bei doktrinär so unverfänglichen Themen wie <strong>der</strong><br />
Literatur <strong>der</strong> Deutschen Klassik nicht von ihrer christlich-katholischen Sicht freimachen.<br />
So kritisiert auch <strong>der</strong> am katholischen Institut in Paris tätige Germanistikprofessor<br />
Robert d’Harcourt Goethes Anthropomorphismus und seine „Entfernung vom<br />
Kreuz“ als die Schattenseiten dieses „hervorragenden Geistes“. 4<br />
Der Artikel über Schiller 5 ist die Besprechung eines Buches desselben Autors, Robert<br />
d’Harcourt. Es handelt von <strong>der</strong> Jugend des deutschen Dichters und Dramatikers. Den<br />
Beitrag verfaßt Albert Garreau, <strong>der</strong> mehrfach als Rezensent deutscher Literatur o<strong>der</strong><br />
ihr gewidmeter Werke hervortritt. Hierbei handelt es sich weniger um eine kritische<br />
Stellungnahme als um eine Wie<strong>der</strong>gabe dessen, was d’Harcourt schreibt. Es sei allen<br />
Franzosen anempfohlen, die die deutsche Seele verstehen wollen. Allein, <strong>der</strong> Leser<br />
erfährt kaum etwas darüber, es sei denn, er bezöge Leben und Einstellung des einzelnen<br />
Menschen Schiller auf die Gesamtheit des deutschen Volkes. Dann allerdings<br />
lebt es in Protestantismus und strenger Disziplin einerseits und ohne Maß und Ordnung<br />
an<strong>der</strong>erseits. 6 Schillers Don Juan sei <strong>der</strong> „deutsche Jüngling“ schlechthin. Er<br />
verkörpere die deutsche Seele, die von Unruhe, innerer Verfügbarkeit („disponibilité“)<br />
und von unbestimmtem aber unerschütterlichem Streben gekennzeichnet ist. 7<br />
<strong>Die</strong>se Charakterisierung vermittelt beinahe den Eindruck, als sei sie nicht nur auf die<br />
Deutschen des 18. Jahrhun<strong>der</strong>ts bezogen, son<strong>der</strong>n ganz gegenwärtig auf die lebenden<br />
Zeitgenossen. <strong>Die</strong>ser Artikel ist ein unpolitischer Beitrag zu Deutschland, aber er<br />
würdigt einen auch in Frankreich bekannten deutschen Dichter und damit das Volk,<br />
aus dessen Mitte er stammt.<br />
Zeitgenössische Literatur <strong>1928</strong>-<strong>1940</strong><br />
Waren die Beiträge zur Philosophie und Goethe-Schiller-Interpretation weitgehend<br />
unpolitisch und wenig qualifizierend für das Deutschlandbild <strong>der</strong> 30er Jahre, so wei-<br />
1 <strong>Vie</strong> int., 10.6.1932, S. 335-352<br />
2 a.a.O., S. 335, 338<br />
3 a.a.O., S. 351<br />
4 a.a.O., Okt.-Dez. 1935, S. 523<br />
5 a.a.O., März 1929, S. 546-552<br />
6 a.a.O., S. 547<br />
7 a.a.O., S. 551<br />
147