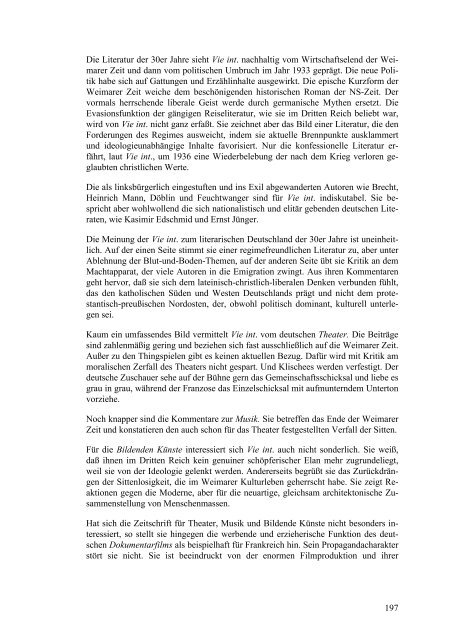Die Deutschlandberichterstattung der Vie Intellectuelle (1928 - 1940 ...
Die Deutschlandberichterstattung der Vie Intellectuelle (1928 - 1940 ...
Die Deutschlandberichterstattung der Vie Intellectuelle (1928 - 1940 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Die</strong> Literatur <strong>der</strong> 30er Jahre sieht <strong>Vie</strong> int. nachhaltig vom Wirtschaftselend <strong>der</strong> Weimarer<br />
Zeit und dann vom politischen Umbruch im Jahr 1933 geprägt. <strong>Die</strong> neue Politik<br />
habe sich auf Gattungen und Erzählinhalte ausgewirkt. <strong>Die</strong> epische Kurzform <strong>der</strong><br />
Weimarer Zeit weiche dem beschönigenden historischen Roman <strong>der</strong> NS-Zeit. Der<br />
vormals herrschende liberale Geist werde durch germanische Mythen ersetzt. <strong>Die</strong><br />
Evasionsfunktion <strong>der</strong> gängigen Reiseliteratur, wie sie im Dritten Reich beliebt war,<br />
wird von <strong>Vie</strong> int. nicht ganz erfaßt. Sie zeichnet aber das Bild einer Literatur, die den<br />
For<strong>der</strong>ungen des Regimes ausweicht, indem sie aktuelle Brennpunkte ausklammert<br />
und ideologieunabhängige Inhalte favorisiert. Nur die konfessionelle Literatur erfährt,<br />
laut <strong>Vie</strong> int., um 1936 eine Wie<strong>der</strong>belebung <strong>der</strong> nach dem Krieg verloren geglaubten<br />
christlichen Werte.<br />
<strong>Die</strong> als linksbürgerlich eingestuften und ins Exil abgewan<strong>der</strong>ten Autoren wie Brecht,<br />
Heinrich Mann, Döblin und Feuchtwanger sind für <strong>Vie</strong> int. indiskutabel. Sie bespricht<br />
aber wohlwollend die sich nationalistisch und elitär gebenden deutschen Literaten,<br />
wie Kasimir Edschmid und Ernst Jünger.<br />
<strong>Die</strong> Meinung <strong>der</strong> <strong>Vie</strong> int. zum literarischen Deutschland <strong>der</strong> 30er Jahre ist uneinheitlich.<br />
Auf <strong>der</strong> einen Seite stimmt sie einer regimefreundlichen Literatur zu, aber unter<br />
Ablehnung <strong>der</strong> Blut-und-Boden-Themen, auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite übt sie Kritik an dem<br />
Machtapparat, <strong>der</strong> viele Autoren in die Emigration zwingt. Aus ihren Kommentaren<br />
geht hervor, daß sie sich dem lateinisch-christlich-liberalen Denken verbunden fühlt,<br />
das den katholischen Süden und Westen Deutschlands prägt und nicht dem protestantisch-preußischen<br />
Nordosten, <strong>der</strong>, obwohl politisch dominant, kulturell unterlegen<br />
sei.<br />
Kaum ein umfassendes Bild vermittelt <strong>Vie</strong> int. vom deutschen Theater. <strong>Die</strong> Beiträge<br />
sind zahlenmäßig gering und beziehen sich fast ausschließlich auf die Weimarer Zeit.<br />
Außer zu den Thingspielen gibt es keinen aktuellen Bezug. Dafür wird mit Kritik am<br />
moralischen Zerfall des Theaters nicht gespart. Und Klischees werden verfestigt. Der<br />
deutsche Zuschauer sehe auf <strong>der</strong> Bühne gern das Gemeinschaftsschicksal und liebe es<br />
grau in grau, während <strong>der</strong> Franzose das Einzelschicksal mit aufmunterndem Unterton<br />
vorziehe.<br />
Noch knapper sind die Kommentare zur Musik. Sie betreffen das Ende <strong>der</strong> Weimarer<br />
Zeit und konstatieren den auch schon für das Theater festgestellten Verfall <strong>der</strong> Sitten.<br />
Für die Bildenden Künste interessiert sich <strong>Vie</strong> int. auch nicht son<strong>der</strong>lich. Sie weiß,<br />
daß ihnen im Dritten Reich kein genuiner schöpferischer Elan mehr zugrundeliegt,<br />
weil sie von <strong>der</strong> Ideologie gelenkt werden. An<strong>der</strong>erseits begrüßt sie das Zurückdrängen<br />
<strong>der</strong> Sittenlosigkeit, die im Weimarer Kulturleben geherrscht habe. Sie zeigt Reaktionen<br />
gegen die Mo<strong>der</strong>ne, aber für die neuartige, gleichsam architektonische Zusammenstellung<br />
von Menschenmassen.<br />
Hat sich die Zeitschrift für Theater, Musik und Bildende Künste nicht beson<strong>der</strong>s interessiert,<br />
so stellt sie hingegen die werbende und erzieherische Funktion des deutschen<br />
Dokumentarfilms als beispielhaft für Frankreich hin. Sein Propagandacharakter<br />
stört sie nicht. Sie ist beeindruckt von <strong>der</strong> enormen Filmproduktion und ihrer<br />
197