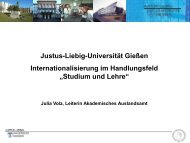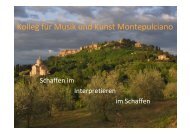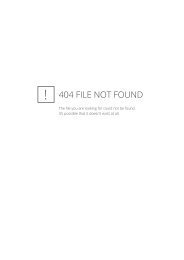Musikhochschulen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts
Musikhochschulen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts
Musikhochschulen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
118 Studien<strong>an</strong>gelegenheiten<br />
Beson<strong>der</strong>s hilfreich scheint <strong>der</strong> aus dem Englischen übernommene Begriff<br />
arts-based Research zu sein, weil er von einer Forschung auf <strong>der</strong><br />
Grundlage von Kunst spricht und sich damit von <strong>der</strong> Erforschung von<br />
Kunst, wie sie die Kunstwissenschaft betreibt, auch sprachlich absetzt.<br />
Diese Bezeichnung, die auch dem in Österreich gebräuchlichen<br />
Verständnis von künstlerischer Forschung zugrunde liegt, sollte auch in<br />
Deutschl<strong>an</strong>d unausgesprochen gemeint sein, wenn von künstlerischer<br />
Forschung die Rede ist.<br />
Daraus ergibt sich folgen<strong>der</strong> Vorschlag für eine Definition:<br />
Künstlerische Entwicklungsvorhaben / künstlerische Forschung im Sinne<br />
von arts-based Research ist die auf <strong>der</strong> Basis künstlerischer Praxis<br />
ausgeübte, systematische und methodische Reflexion über die<br />
Produktion, Interpretation und Rezeption eines Kunstwerks mit dem Ziel,<br />
zu Erkenntnissen zu gel<strong>an</strong>gen, die sich nur aus <strong>der</strong> Interaktion von<br />
Wissenschaft und Kunstpraxis ergeben.<br />
5. Beispiele künstlerischer Entwicklungsvorhaben<br />
Um die Abgrenzung künstlerischer Forschung gegenüber einer<br />
musikwissenschaftlichen Forschung zu konkretisieren, seien hier einige<br />
typische Beispiele künstlerischer Entwicklungsvorhaben bzw.<br />
künstlerischer Forschung aufgeführt:<br />
a) Historische Aufführungspraxis<br />
„Jahrzehnte l<strong>an</strong>g st<strong>an</strong>d <strong>der</strong> Reson<strong>an</strong>zkörper im Zentrum <strong>der</strong> Bemühungen<br />
um authentische Streicherpraxis. Dabei sind in erster Linie <strong>der</strong> Bogen und<br />
das korrespondierende Saitenmaterial für die Erzeugung und Formung<br />
eines repertoiretypischen Streicherkl<strong>an</strong>gs ver<strong>an</strong>twortlich. Original<br />
erhaltene Streichbögen liefern konkrete Informationen zur Spielpraxis<br />
ihrer Zeit. Das Forschungsziel besteht darin, Bögen aus dem Umfeld <strong>des</strong><br />
Wiener Repertoires um 1825 überhaupt wissenschaftlich zu identifizieren<br />
und durch Nachbauten <strong>der</strong> Musikpraxis zur Verfügung zu stellen.<br />
Längerfristig ist es das Ziel, auf die Bedeutung <strong>des</strong> Bogens und seiner<br />
repertoirespezifischen Spieleigenschaften für die Interpretation<br />
hinzuweisen und eine Methode zu <strong>der</strong>en Beschreibung bereitzustellen.“ 42<br />
42 Hochschule <strong>der</strong> Künste Bern (Hrsg.): Forschung - Jahrbuch Nr. 4 /2009, Abschnitt 2.2