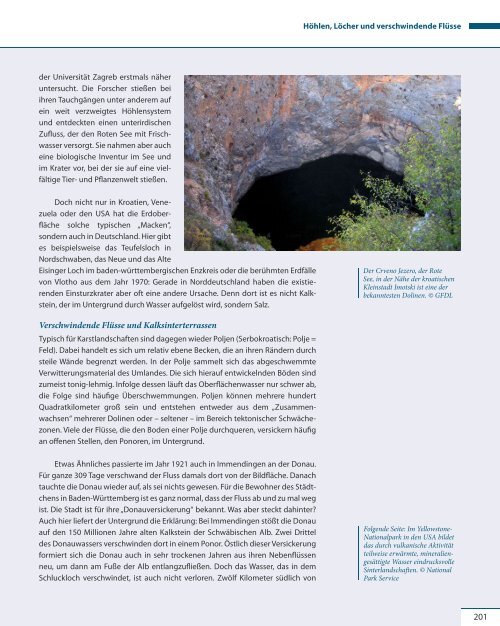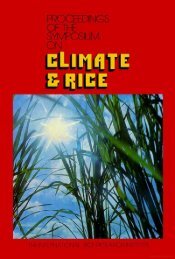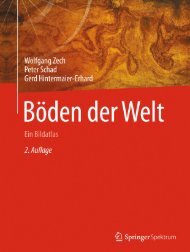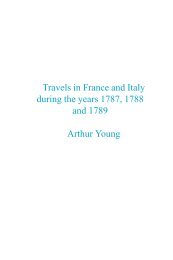bok%3A978-3-642-01313-3
bok%3A978-3-642-01313-3
bok%3A978-3-642-01313-3
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Höhlen, Löcher und verschwindende Flüsse<br />
der Universität Zagreb erstmals näher<br />
untersucht. Die Forscher stießen bei<br />
ihren Tauchgängen unter anderem auf<br />
ein weit verzweigtes Höhlensystem<br />
und entdeckten einen unterirdischen<br />
Zufluss, der den Roten See mit Frischwasser<br />
versorgt. Sie nahmen aber auch<br />
eine biologische Inventur im See und<br />
im Krater vor, bei der sie auf eine vielfältige<br />
Tier- und Pflanzenwelt stießen.<br />
Doch nicht nur in Kroatien, Venezuela<br />
oder den USA hat die Erdoberfläche<br />
solche typischen „Macken“,<br />
sondern auch in Deutschland. Hier gibt<br />
es beispielsweise das Teufelsloch in<br />
Nordschwaben, das Neue und das Alte<br />
Eisinger Loch im baden-württembergischen Enzkreis oder die berühmten Erdfälle<br />
von Vlotho aus dem Jahr 1970: Gerade in Norddeutschland haben die existierenden<br />
Einsturzkrater aber oft eine andere Ursache. Denn dort ist es nicht Kalkstein,<br />
der im Untergrund durch Wasser aufgelöst wird, sondern Salz.<br />
Der Crveno Jezero, der Rote<br />
See, in der Nähe der kroatischen<br />
Kleinstadt Imotski ist eine der<br />
bekanntesten Dolinen. © GFDL<br />
Verschwindende Flüsse und Kalksinterterrassen<br />
Typisch für Karstlandschaften sind dagegen wieder Poljen (Serbokroatisch: Polje =<br />
Feld). Dabei handelt es sich um relativ ebene Becken, die an ihren Rändern durch<br />
steile Wände begrenzt werden. In der Polje sammelt sich das abgeschwemmte<br />
Verwitterungsmaterial des Umlandes. Die sich hierauf entwickelnden Böden sind<br />
zumeist tonig-lehmig. Infolge dessen läuft das Oberflächenwasser nur schwer ab,<br />
die Folge sind häufige Überschwemmungen. Poljen können mehrere hundert<br />
Quadratkilometer groß sein und entstehen entweder aus dem „Zusammenwachsen“<br />
mehrerer Dolinen oder – seltener – im Bereich tektonischer Schwächezonen.<br />
Viele der Flüsse, die den Boden einer Polje durchqueren, versickern häufig<br />
an offenen Stellen, den Ponoren, im Untergrund.<br />
Etwas Ähnliches passierte im Jahr 1921 auch in Immendingen an der Donau.<br />
Für ganze 309 Tage verschwand der Fluss damals dort von der Bildfläche. Danach<br />
tauchte die Donau wieder auf, als sei nichts gewesen. Für die Bewohner des Städtchens<br />
in Baden-Württemberg ist es ganz normal, dass der Fluss ab und zu mal weg<br />
ist. Die Stadt ist für ihre „Donauversickerung“ bekannt. Was aber steckt dahinter?<br />
Auch hier liefert der Untergrund die Erklärung: Bei Immendingen stößt die Donau<br />
auf den 150 Millionen Jahre alten Kalkstein der Schwäbischen Alb. Zwei Drittel<br />
des Donauwassers verschwinden dort in einem Ponor. Östlich dieser Versickerung<br />
formiert sich die Donau auch in sehr trockenen Jahren aus ihren Nebenflüssen<br />
neu, um dann am Fuße der Alb entlangzufließen. Doch das Wasser, das in dem<br />
Schluckloch verschwindet, ist auch nicht verloren. Zwölf Kilometer südlich von<br />
Folgende Seite: Im Yellowstone-<br />
Nationalpark in den USA bildet<br />
das durch vulkanische Aktivität<br />
teilweise erwärmte, mineraliengesättigte<br />
Wasser eindrucksvolle<br />
Sinterlandschaften. © National<br />
Park Service<br />
201