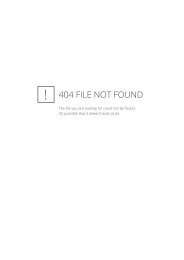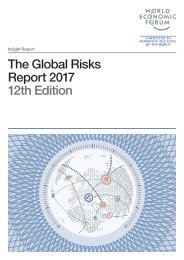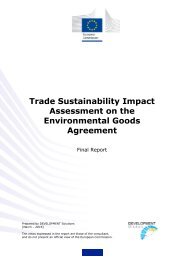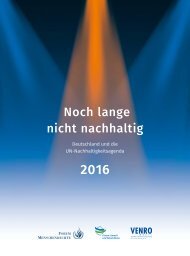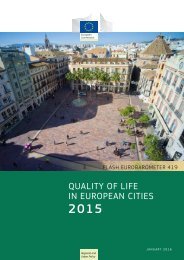Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3836<br />
3837<br />
3838<br />
3839<br />
3840<br />
3841<br />
3842<br />
3843<br />
3844<br />
3845<br />
3846<br />
3847<br />
3848<br />
3849<br />
3850<br />
3851<br />
3852<br />
3853<br />
3854<br />
3855<br />
3856<br />
3857<br />
3858<br />
3859<br />
3860<br />
3861<br />
3862<br />
3863<br />
3864<br />
3865<br />
3866<br />
3867<br />
3868<br />
3869<br />
3870<br />
3871<br />
3872<br />
3873<br />
3874<br />
3875<br />
3876<br />
3877<br />
3878<br />
3879<br />
3880<br />
3881<br />
3882<br />
3883<br />
3884<br />
3885<br />
3886<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Ostdeutschland, die zu einer Dämpfung der Nachfrage nach technisch orientiertem Personal führten. Diese<br />
Konstellation gibt es inzwischen nicht mehr. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Arbeitslosigkeit von<br />
Fachkräften in der Zukunft einem chronischen Fachkräftemangel weichen – durch die demografische<br />
Entwicklung und die wiedergewonnene hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, die den Bedarf an<br />
qualifiziertem Personal beflügelt.<br />
Die chronische Knappheit an Fachkräften wird die Arbeitsteilung verändern. Unternehmen werden alles<br />
daransetzen, ihre kreativsten Köpfe so einzusetzen, dass die Knappheit kreativer Köpfe nicht zu einem Einbruch<br />
der Innovationskraft führt. Das heißt: Entlastung von rein administrativen Aufgaben, bessere Bezahlung und<br />
Motivation zur Forschung, Veränderung der Unternehmenshierarchien mit besseren Aufstiegsperspektiven für<br />
Menschen, die forschen statt verwalten. Dies wird vor allem jungen Menschen nützen, die typischerweise über<br />
ein hohes Maß an Originalität, Unvoreingenommenheit und Risikobereitschaft verfügen – im Unterschied zu<br />
Älteren, die ihre Stärken in der Erfahrung sowie der Kommunikationsfähigkeit haben. Also: ein Strukturwandel<br />
zugunsten der „fluiden“ gegenüber der „kristallinen“ Intelligenz, die allerdings auch eine Zunahme der<br />
Nachfrage spüren wird, und zwar durch die Knappheit an Arbeitskraft insgesamt. Dies geschieht indirekt: Ältere<br />
Menschen werden für administrative Aufgaben zunehmend gebraucht, eben weil die Jungen mit ihren „fluiden“<br />
Fähigkeiten extrem knapp werden. Gleichzeitig wird es Bemühungen geben, die Alterung mit Blick auf die<br />
Innovationsfähigkeit „hinauszuschieben“: Produktive Menschen, die forschen, werden motiviert, noch länger in<br />
der betrieblichen Forschung zu bleiben – und nicht allzu früh, wie heute üblich, in Bereiche der Administration<br />
und <strong>des</strong> Managements zu wechseln. Gleichzeitig werden Ältere motiviert, ihre Lebensarbeitszeit zu verlängern,<br />
um die Lücken in diesen Bereichen zu füllen.<br />
Kurzum: Es kann zu einer umfassenden Mobilisierung von Arbeitskraft kommen, die tendenziell zu mehr<br />
Effizienz, Innovation und Wachstum führt und damit den Folgen von Schrumpfung und Alterung <strong>des</strong><br />
Erwerbspersonenpotenzials entgegenwirkt. 175 Es ist heute allerdings noch Spekulation, wie weit ein solcher<br />
Prozess tatsächlich gehen wird. Entscheidend wird sein, inwieweit ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
verstärkt Aufgaben übernehmen können, die vorher von Jüngeren ausgeführt wurden, und ob es dabei<br />
gesamtwirtschaftlich zu Gewinnen oder Verlusten der Wertschöpfung kommt. Diese Fragen sind Gegenstand der<br />
Forschung zur Altersproduktivität, die erst in ihren Anfängen steckt. Die traditionelle Vorstellung, also<br />
gewissermaßen der Startpunkt der Forschung, ist dabei, dass es – gewissermaßen zwingend – zu einer Abnahme<br />
der Produktivität im Alter kommt, und zwar vor allem durch die Verschlechterung der körperlichen und<br />
kognitiven Fähigkeiten. Neuere Forschungen, allen voran vom Munich Institute for the Economics of Ageing,<br />
zeigen dagegen für eine Reihe von Tätigkeiten, dass der Prozess sehr viel langsamer verläuft, als man bisher<br />
geglaubt hat. Zusätzlich zeigen sie, dass gerade bei Tätigkeiten mit Routinecharakter die Erfahrung eine<br />
unerwartet starke Rolle spielt, um kognitiv bedingte Fehler zu vermeiden – mit dem verblüffenden Ergebnis,<br />
dass es sogar bei Älteren zu einer höheren Arbeitsproduktivität als bei Jüngeren kommt, vor allem weil weniger<br />
(schwere) Fehler gemacht werden. 176 In die gleiche Richtung werden wahrscheinlich neue Technologien am<br />
Arbeitsplatz wirken: Gerade die dringliche Nachfrage nach älteren Arbeitskräften wird für die Unternehmen den<br />
Anreiz schaffen, durch Produktinnovationen und Investitionen die Ausstattung am Arbeitsplatz „altersgerecht“<br />
zu gestalten. Auch in dieser Hinsicht könnte sich also ein Wandel einstellen, der zur Abflachung der bisher<br />
vermuteten Kurve der Altersproduktivität beiträgt.<br />
Kurzum: Wir wissen bisher sehr wenig über die Reaktion der deutschen Volkswirtschaft auf die zu erwartende<br />
Alterung der Erwerbstätigen. Zwar handelt es sich bei der Alterung der Bevölkerung keineswegs um ein neues<br />
Phänomen, denn es gibt sie schon seit den 1980er Jahren. Allerdings fand sie bisher in einem<br />
gesamtwirtschaftlichen Zustand der Arbeitslosigkeit statt; dieser erlaubte es, ihre Wirkung auf das<br />
Durchschnittsalter der Beschäftigten deutlich abzufedern, durch frühe Verrentung älterer und Neueinstellung<br />
junger Arbeitnehmer. Dies wird in der Zukunft nicht mehr möglich sein, und genau daraus ergeben sich<br />
machtvolle ökonomische Anpassungen, die bisher weder bekannt noch erforscht sind. Die politische<br />
Herausforderung wird darin bestehen, diese Anpassungen „positiv zu begleiten“, also sie nicht durch allzu rigide<br />
Vorgaben der Regulierung zu erschweren. Dies gilt für den Staat und die Tarifparteien gleichermaßen.<br />
Aus ökonomischer Sicht ist zu vermuten, dass die Möglichkeiten der Verbesserung der Arbeitsteilung zwischen<br />
Generationen – weil bisher kaum nötig und gefordert – möglicherweise erheblich mehr Potenzial zur Stärkung<br />
der künftigen Innovationskraft enthalten als viele bildungspolitische Versuche der Veränderung durch den Staat.<br />
175<br />
Dazu ausführlich Paqué (2012): Abschnitt 2.3 mit weiterführenden Literaturhinweisen.<br />
176<br />
Dazu im Einzelnen Paqué (2012): Abschnitt 2.3, insbesondere mit einer Diskussion der neuesten Ergebnisse<br />
einer Forschergruppe <strong>des</strong> Munich Institute for the Economics of Ageing unter der Leitung von Axel Börsch-<br />
Supan.<br />
103