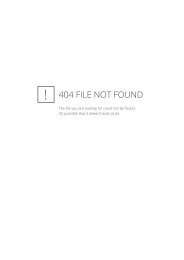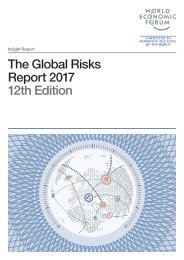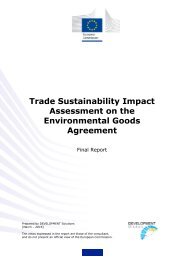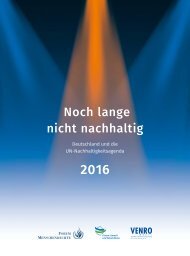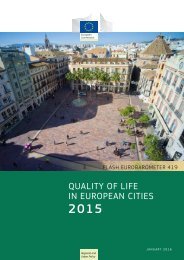Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
1801<br />
1802<br />
1803<br />
1804<br />
1805<br />
1806<br />
1807<br />
1808<br />
1809<br />
1810<br />
1811<br />
1812<br />
1813<br />
1814<br />
1815<br />
1816<br />
1817<br />
1818<br />
1819<br />
1820<br />
1821<br />
1822<br />
1823<br />
1824<br />
1825<br />
1826<br />
1827<br />
1828<br />
1829<br />
1830<br />
1831<br />
1832<br />
1833<br />
1834<br />
1835<br />
1836<br />
1837<br />
1838<br />
1839<br />
1840<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Diese Transformation sorgt dafür, dass ein (reales) Wachstum <strong>des</strong> BIP stets auf eine von drei Ursachen<br />
zurückgeführt werden kann:<br />
a) die Zunahme der Menge der eingesetzten Ressourcen Arbeit, Kapital, Land, Energie und Rohstoffe,<br />
b) die Zunahme von deren Leistungsfähigkeit im Herstellungsprozess („Produktivität“) und<br />
c) die Verbesserung der Qualität <strong>des</strong> Produzierten.<br />
Dabei ist in der statistischen Praxis oft nicht genau feststellbar, welche Ursache dominiert. Soweit tatsächlich das<br />
gemessene reale Wachstum auf Qualitätsverbesserungen beruht, ist es allerdings nicht sinnvoll, es als reines<br />
Mengenwachstum zu interpretieren. Dies gilt besonders für langfristige Aussagen zum Wachstum, da der<br />
Strukturwandel über lange Zeiträume natürlich besonders breit ausfällt und tief greift – bis hin zum Entstehen<br />
völlig neuer Güterwelten, wie schon ein flüchtiger Vergleich der Produktpalette in Deutschland in den 1980er<br />
Jahren mit der heutigen deutlich macht. Und es gilt vor allem für hoch entwickelte Industrienationen, denn deren<br />
Wachstum besteht heute zu einem Großteil aus verbesserter Produktqualität und zunehmender Produktvielfalt<br />
und nicht aus immer mehr vom Gleichen. Ein solches wirklich „quantitatives“ Wachstum findet sich eigentlich<br />
nur noch in den sehr frühen Stadien <strong>des</strong> Wachstums von Entwicklungs- und Schwellenländern, wo zunächst<br />
elementare Bedürfnisse der Menschen nach mehr Nahrung, Wohnraum und Kleidung befriedigt werden, bevor<br />
dann erst in einem späteren Entwicklungsstadium Qualität und Vielfalt der Güter in den Vordergrund rücken. 13<br />
2.2 Die Rolle <strong>des</strong> Wissens<br />
Die volkswirtschaftliche Wachstumstheorie begreift die (reale) Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft als einen<br />
Prozess <strong>des</strong> Zusammenwirkens von Produktionsfaktoren zum Zweck der Herstellung von Gütern, und zwar bei<br />
dem jeweils gegebenen Stand <strong>des</strong> technischen Wissens. Die Zahl der Produktionsfaktoren ist dabei grundsätzlich<br />
offen. Üblich sind maximal vier, nämlich Land, Arbeitskraft sowie Sach- und Humankapital. Ihre Verfügbarkeit<br />
ist veränderlich, allerdings in gesellschaftlich und historisch sehr unterschiedlichem Maße. Die Fläche <strong>des</strong><br />
nutzbaren Lan<strong>des</strong> sowie die Anzahl der Arbeitskräfte sind Ergebnis von historischen, gesellschaftlichen und<br />
demografischen Prozessen, die sich selbst auf längere Sicht nur sehr langsam verändern und politisch nur sehr<br />
schwer steuerbar sind. Dies gilt zumin<strong>des</strong>t im dicht besiedelten, hoch entwickelten Deutschland mit seiner<br />
freiheitlich-demokratischen Verfassung. Anders steht es bei Sach- und Humankapital: Diese sind grundsätzlich<br />
akkumulierbar, und zwar durch gezielte Investitionen etwa in modernere Maschinen und verbesserte Bildung.<br />
Ähnliches gilt für den Stand <strong>des</strong> marktfähigen technischen Wissens, das sich permanent erhöht, und zwar als<br />
Konsequenz von öffentlicher und privatwirtschaftlicher Forschung und Entwicklung sowie von betrieblichen<br />
Lernprozessen auf allen Ebenen.<br />
Für ein tieferes Verständnis von Wachstum bedarf es vor allem einer Erklärung, was die Akkumulation von<br />
Human- und Sachkapital sowie die Zunahme <strong>des</strong> marktfähigen Wissens treibt. Für hoch entwickelte<br />
Industrieländer lautet die Antwort: Es ist auf lange Sicht allein die Innovationskraft der Wirtschaft und<br />
Gesellschaft, also deren Fähigkeit, neue Produkt- und Verfahrensideen zu entwickeln, die sich dann in neuen<br />
Waren und Dienstleistungen sowie neuen Produktionstechniken niederschlagen. Warum dies so ist, lässt sich<br />
schnell erkennen, wenn man unterstellt, die gesellschaftliche Kraft zur Innovation würde zum Stillstand<br />
kommen. Dies hätte zum einen zur Folge, dass die vorhandene Technik keinen Fortschritt mehr machte. Es hätte<br />
zum anderen sehr schnell die Konsequenz, dass es keinen Anreiz mehr gäbe, den Maschinenbestand – oder<br />
allgemeiner: das Sachkapital – der Wirtschaft zu erneuern, weil ja der vorhandene Bestand bereits bestmöglich<br />
arbeitet. Außer Ersatzinvestitionen gäbe es nichts mehr, wofür die Ersparnis, also der Konsumverzicht,<br />
13<br />
Gelegentlich wird explizit zwischen „Wachstum“ als quantitativer und „Entwicklung“ als qualitativer<br />
Erscheinung unterschieden. Mit Blick auf die VGR ist diese Unterscheidung für eine Wirtschaft wie die deutsche<br />
gegenstandslos, denn das in der VGR ausgewiesene Wachstum ist wegen der beschriebenen Transformation von<br />
Qualität in Quantität zu großen Teilen genau das, was der Begriff „Entwicklung“ beschreiben soll. Eine explizite<br />
Unterscheidung zwischen Wachstum und Entwicklung führt <strong>des</strong>halb aus volkswirtschaftlicher Sicht in die Irre.<br />
Solange der Begriff „Qualität“ in der (präzisen) Weise definiert wird, wie es die Wirtschaftswissenschaft und die<br />
Statistik tun, nämlich als Verbesserung von Produkteigenschaften und -vielfalt, bleibt die Unterscheidung von<br />
Wachstum und Entwicklung rein semantisch. Tatsächlich ist wirtschaftliches Wachstum stets das Ergebnis einer<br />
gesellschaftlichen Entwicklung, die in der sogenannten Wachstumstheorie, einer etablierten Disziplin der<br />
Volkswirtschaftslehre, gedanklich geordnet und formal dargestellt wird. Weltweit anerkannte, moderne<br />
Standardlehrbücher zur Wachstumstheorie sind unter anderem Acemoglu, Daron (2009). Introduction to Modern<br />
Economic Growth; sowie Aghion, Philippe; Howitt, Peter (2009). The Economics of Growth; und Barro, Robert<br />
J.; Sala-i-Martin, Xavier (2004). Economic Growth.<br />
47