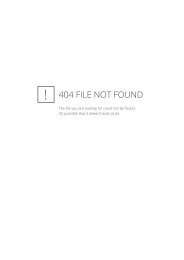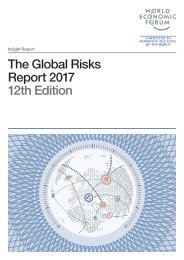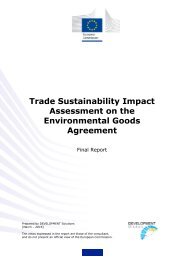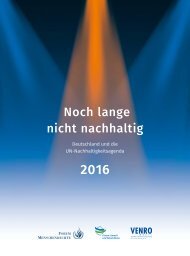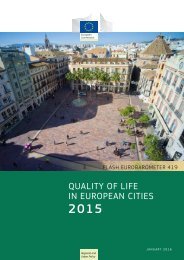Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1879<br />
1880<br />
1881<br />
1882<br />
1883<br />
1884<br />
1885<br />
1886<br />
1887<br />
1888<br />
1889<br />
1890<br />
1891<br />
1892<br />
1893<br />
1894<br />
1895<br />
1896<br />
1897<br />
1898<br />
1899<br />
1900<br />
1901<br />
1902<br />
1903<br />
1904<br />
1905<br />
1906<br />
1907<br />
1908<br />
1909<br />
1910<br />
1911<br />
1912<br />
1913<br />
1914<br />
1915<br />
1916<br />
1917<br />
1918<br />
1919<br />
1920<br />
1921<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Tatsächlich lässt sich erst im Nachhinein wirklich zweifelsfrei feststellen, ob es sich bei einer massiven<br />
Aufwertung von Vermögensbeständen in einem Land um ein realwirtschaftlich begründetes Phänomen oder eine<br />
reine Blase handelt. Denn die Verteuerung von Vermögensbeständen und auch von lokalen Dienstleistungen im<br />
Zuge <strong>des</strong> Wachstums ist für sich genommen völlig normal, soweit es um die Übertragung von<br />
Produktivitätssteigerungen aus jenen Sektoren der Wirtschaft geht, die im weltwirtschaftlichen Wettbewerb<br />
stehen. 19 Nimmt zum Beispiel im verarbeitenden Gewerbe („Industrie“) die Arbeitsproduktivität und damit das<br />
Lohnniveau zu, überträgt sich diese Zunahme über den Wettbewerb um Arbeitskräfte und Flächen auch auf die<br />
lokalen Dienstleistungen, die möglicherweise keinen entsprechenden Produktivitätsfortschritt erleben. Dadurch<br />
verteuert sich der Preis dieser lokalen Dienstleistungen: Löhne, Mieten und Pachten steigen, Land und Menschen<br />
gewinnen an Wert und damit nimmt die Wertschöpfung insgesamt zu, und zwar nicht nur in der Industrie. Genau<br />
dies ist der Grund, warum Zentren der industriellen Innovationskraft - wie in Deutschland zum Beispiel die<br />
Großräume München und Stuttgart - im Vergleich zur Peripherie sehr hohe Lebenshaltungskosten aufweisen.<br />
Es dürfte nicht überraschen, dass es im Vorhinein extrem schwierig ist zu entscheiden, ob ein beobachtetes<br />
Wachstum eine angemessene „reale“ Wertsteigerung oder eine Blase ist. Tatsächlich bedarf es einer Vielzahl<br />
von gesamtwirtschaftlichen Indikatoren, die aussagekräftige Hinweise darauf geben, ob eine Situation dauerhaft<br />
oder nicht dauerhaft ist. Die besondere Schwierigkeit für externe Beobachterinnen und Beobachter liegt<br />
allerdings darin, dass die Finanzmärkte selbst permanent alle relevanten Informationen verarbeiten, die sich dann<br />
über entsprechende Kauf- und Verkaufsentscheidungen in den Kurswerten niederschlagen. Es erfordert <strong>des</strong>halb<br />
einen beträchtlichen diagnostischen und prognostischen Mut festzustellen, dass eine aktuell beobachtete<br />
Konstellation von Preisen an den Vermögensmärkten tatsächlich „unhaltbar“ ist. In jedem Fall fließen in solche<br />
Urteile oft subjektive Wertungen ein, die nur schwer auf eine verlässliche objektive Grundlage zu stellen sind.<br />
2.4 Freizeitkonsum und häusliche Produktion<br />
Wirtschaftswachstum ist durch neues technisches Wissen bedingt, aber nicht je<strong>des</strong> neue technische Wissen führt<br />
zu mehr gemessenem Wirtschaftswachstum. Denn die Menschen können sich - bewusst und freiwillig – dafür<br />
entscheiden, ihre erhöhte wirtschaftliche Leistungskraft ganz oder zum Teil zu nutzen, um weniger zu arbeiten<br />
und statt<strong>des</strong>sen mehr Freizeit zu genießen. Wenn nur die Nachfrage nach Freizeit hinreichend<br />
„einkommenselastisch“ ist, also auf das gestiegene Einkommen besonders stark reagiert, kann das gemessene<br />
BIP sogar abnehmen. Die Produktivkraft <strong>des</strong> zusätzlichen Wissens wird dann also in Form von Freizeit<br />
vollständig „konsumiert“ - statt in Form von zusätzlichen Gütern, die mit zusätzlichem Einkommen erworben<br />
werden könnten. Allerdings: Auch unter diesen Umständen ist es erst das zusätzliche Wissen, das den Menschen<br />
zusätzlichen Konsum möglich macht, und zwar in der speziellen Form der freien Zeit. Lediglich die Art der<br />
Messung, die sich auf den Marktwert <strong>des</strong> Produzierten beschränkt, weist „Schrumpfung“ oder „Stagnation“ statt<br />
„Wachstum“ aus. Ein erweitertes Konzept, das den Wert der Freizeit mit berücksichtigt – etwa durch<br />
Berechnung der Opportunitätskosten der Freizeit als dem entgangenen Lohn – würde den Wohlstand in einer<br />
Volkswirtschaft ausweisen, wobei Wohlstand sich anhand von Konsum und Freizeit und möglicherweise vieler<br />
anderer Aspekte bemisst. 20 Den Wert der Freizeit „korrekt“ zu messen, stößt aber bei der Umsetzung auf<br />
erhebliche praktische Probleme. 21<br />
In der empirischen Realität spielen Unterschiede im (freiwilligen) Freizeitkonsum eine beachtliche Rolle, und<br />
zwar mit Blick sowohl auf (sehr) langfristige Wachstumstrends als auch auf den internationalen Vergleich von<br />
Wohlstandsniveaus. So ist in Deutschland seit 1870 die jährliche Arbeitszeit einer oder eines Beschäftigten um<br />
mehr als 50 Prozent gesunken, und zwar im Wesentlichen durch Verkürzung der Wochenarbeitszeit und durch<br />
zusätzliche Urlaubstage. Dies bedeutet – zumin<strong>des</strong>t rein rechnerisch – einen weitgehend freiwilligen Verzicht<br />
auf ein doppelt so hohes Einkommensniveau. Ähnliches gilt für den internationalen Vergleich. So lässt sich der<br />
19<br />
Dieses Phänomen wird in der Außenhandelstheorie als „Balassa-Samuelson-Effekt“ bezeichnet. Vgl. Balassa,<br />
Béla A. (1964). The Purchasing-Power Parity Doctrine; Samuelson, Paul A. (1964). Theoretical Notes on Trade<br />
Problems. Eine moderne formale Darstellung findet sich bei Harms, Philipp (2008). Internationale<br />
Makroökonomik: 285-290.<br />
20<br />
Es ist Auftrag der Projektgruppe 2 „Entwicklung eines ganzheitlichen Wohlstands- beziehungsweise<br />
Fortschrittsindikators“ zu untersuchen, welche Aspekte für Wohlstand und auch Lebensqualität eine Rolle<br />
spielen.<br />
21<br />
Entsprechende Berechnungsversuche wurden schon in den 1970er Jahren vorgelegt und führten stets zu einer<br />
kaum mehr sinnvoll interpretierbaren Aufblähung der Messgrößen. Dies gilt insbesondere für den Vergleich von<br />
„reichen“ und „armen“ Ländern, da der Wert der Freizeit dann und nur dann mit dem entgangenen Lohn<br />
bemessen werden darf, wenn der Zustand der Freizeit „freiwillig“ gewählt wurde und nicht das Ergebnis<br />
unfreiwilliger Unterbeschäftigung ist. Genau dies ist aber zumeist nicht zweifelsfrei zu klären.<br />
49