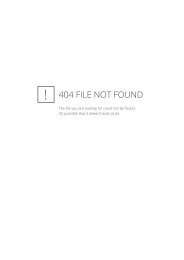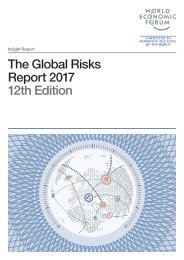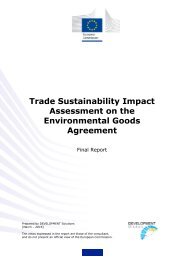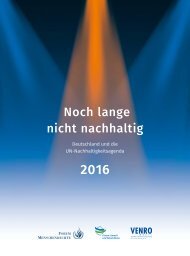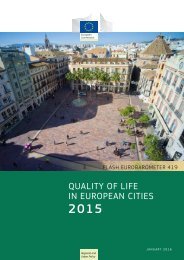Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4343<br />
4344<br />
4345<br />
4346<br />
4347<br />
4348<br />
4349<br />
4350<br />
4351<br />
4352<br />
4353<br />
4354<br />
4355<br />
4356<br />
4357<br />
4358<br />
4359<br />
4360<br />
4361<br />
4362<br />
4363<br />
4364<br />
4365<br />
4366<br />
4367<br />
4368<br />
4369<br />
4370<br />
4371<br />
4372<br />
4373<br />
4374<br />
4375<br />
4376<br />
4377<br />
4378<br />
4379<br />
4380<br />
4381<br />
4382<br />
4383<br />
4384<br />
4385<br />
4386<br />
4387<br />
4388<br />
4389<br />
4390<br />
4391<br />
4392<br />
4393<br />
4394<br />
4395<br />
4396<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Wandlungsfähigkeit lässt die Soziale Marktwirtschaft auch in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen<br />
weiterhin als bestens geeignetes Wirtschaftsmodell erscheinen.<br />
Kapitel 3.2 stellt die Wechselwirkungen zwischen Wachstum und den öffentlichen Haushalten dar. Dieses<br />
Verhältnis ist in erster Linie geprägt durch die Staatsverschuldung, die seit Beginn der 1970er Jahre in<br />
Deutschland kontinuierlich zugenommen hat. So verwundert es nicht, dass das Kapitel auch in erster Linie auf<br />
die Risiken einer dauerhaft hohen Staatsverschuldung eingeht. Neben dem gemeinhin bekannten Umstand, dass<br />
heutige Schulden den finanziellen Handlungsspielraum in Zukunft beschränken und damit eine Umverteilung<br />
innerhalb nachfolgender Generationen darstellen, wird auch auf den „Crowding-out“-Effekt der<br />
Staatsverschuldung eingegangen: Durch steigende Staatsverschuldung steigen auch das Risiko <strong>des</strong><br />
Zahlungsausfalls und damit der Zins, den Staaten bei der Begebung von Staatsanleihen gewähren müssen.<br />
Gleichzeitig benötigen auch private Unternehmen Fremdkapital, um Investitionen zu finanzieren. Jedoch können<br />
Unternehmen ab einem gewissen öffentlichen Verschuldungsstand nicht mehr mit der Verzinsung der<br />
Staatsanleihen mithalten, weshalb private Kapitalgeber dann eher geneigt sind, ihr Geld in Staatsanleihen als in<br />
Unternehmen zu investieren. Der Staat verdrängt so die private Kapitalnachfrage.<br />
Neben diesen eher negativen Aspekten wird in Kapitel 3.2 jedoch auch ausgeführt, dass den staatlichen Schulden<br />
im Sinne einer gesamtwirtschaftlichen Saldenbilanz Vermögenspositionen gegenüberstehen. Entgegen der<br />
landläufigen Meinung werden diese Vermögenspositionen aber nicht etwa mehrheitlich von Banken, sondern in<br />
erster Linie von Privatpersonen und Unternehmen der Realwirtschaft gehalten.<br />
Kapitel 3.3 stellt den Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem Wachstum und einem funktionierenden<br />
Finanzmarkt heraus. Dabei wird deutlich, dass dem Finanzmarkt zwei unentbehrliche Funktionen im<br />
gesamtwirtschaftlichen Gefüge zukommen: die Kapitalakkumulation und die Kapitalallokation. Erstere stellt im<br />
Wesentlichen auf den Umstand ab, dass einzelne Investoren meist nur kleine Ersparnisse anbieten können,<br />
während Unternehmen für die Finanzierung von Investitionen meist umfangreiche Kredite benötigen. Der<br />
Finanzmarkt transformiert die kleinen Ersparnisse in großvolumige Kredite und ermöglicht so die Erhaltung und<br />
Erweiterung <strong>des</strong> gesamtwirtschaftlichen Kapitalstocks durch die Finanzierung von Investitionen. Die Funktion<br />
der Kapitalallokation beinhaltet die Zuführung <strong>des</strong> knappen Kapitals in die besten Verwendungszwecke – dies<br />
geschieht insbesondere durch den Abbau von Informationsasymmetrien und die Senkung von<br />
Transaktionskosten. Insgesamt kommt dem Finanzmarkt also eine finanzielle Mediatorfunktion zwischen<br />
Privatpersonen und Unternehmen beziehungsweise dem Staat zu.<br />
Kapitel 3.3 geht jedoch auch auf die jüngste Entwicklung ein, in der die „dienende“ Funktion <strong>des</strong> Finanzmarkts<br />
immer stärker in den Hintergrund rückte. Statt<strong>des</strong>sen entwickelte der Finanzmarkt – begünstigt durch<br />
fortschreitende Deregulierung in fast allen OECD-Staaten – ein Eigenleben: Mit eigenen Produkten, eigenen<br />
Regeln und einer eigener Dynamik, die sich immer stärker von der Entwicklung in der Realwirtschaft entfernte<br />
und schließlich in der Finanz- und nachfolgenden Wirtschaftskrise der Jahre 2008/09 mündete. Um die<br />
Entwicklung auf dem Finanzmarkt wieder stärker an diejenige in der Realwirtschaft zu koppeln, werden – ohne<br />
der Projektgruppe 4 der Enquete-Kommission zu sehr vorgreifen zu wollen – einige mögliche<br />
ordnungspolitische Maßnahmen skizziert, die teilweise bereits in der Umsetzung begriffen sind. Hierzu zählen<br />
vor allem die Reduzierung der Haftungsbeschränkung in Form einer höheren Eigenkapitalunterlegung von<br />
Finanzmarktgeschäften, die Trennung von Beratung und Bewertung innerhalb der Ratingagenturen und eine<br />
Bankenaufsicht auf europäischer oder globaler Ebene, die die verschärften regulatorischen Rahmenbedingungen<br />
auch effektiv durchsetzen kann.<br />
Kapitel 3.4 beleuchtet den Einfluss unternehmerischen Handelns auf das wirtschaftliche Wachstum einer<br />
Volkswirtschaft. Unternehmen sind die entscheidenden Innovatoren innerhalb einer Volkswirtschaft, sie<br />
entdecken und koordinieren Marktchancen, tragen aber auch das Risiko <strong>des</strong> Scheiterns. Zudem transformieren<br />
sie das Wissen aus staatlicher beziehungsweise öffentlicher Grundlagenforschung in marktgängiges Wissen und<br />
sorgen so für jenen technischen Fortschritt, der letztlich in wirtschaftlichem Wachstum mündet. Durch<br />
Investitionen tragen sie zudem einen erheblichen Teil zum Kapitalstock und damit zum materiellen<br />
Wohlstandsniveau einer Volkswirtschaft bei.<br />
Das wirtschaftswissenschaftliche Bild <strong>des</strong> Verhältnisses von Unternehmen zur Gesellschaft hat sich in den<br />
vergangenen rund 40 Jahren stark verändert. War man in den 1970er Jahren noch der Ansicht, Unternehmen<br />
sollten sich ausschließlich auf die Gewinnerzielung und Reinvestition dieser Gewinne in Produktionsmittel<br />
konzentrieren, ist man nun der Überzeugung, dass Unternehmen gesellschaftliche Akzeptanz benötigen, um<br />
langfristig Gewinne erwirtschaften zu können. Daher sollten Investitionen nicht nur in die Produktion, sondern<br />
auch in die „gesellschaftliche Zusammenarbeit“ fließen. Hierzu zählt vor allem die Personal- und<br />
116