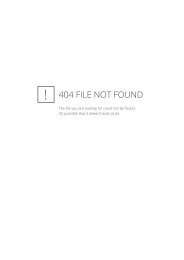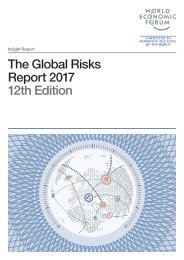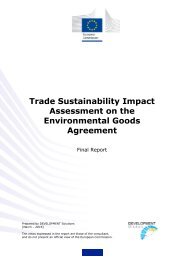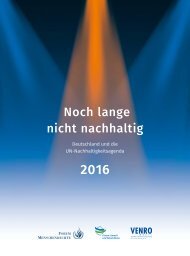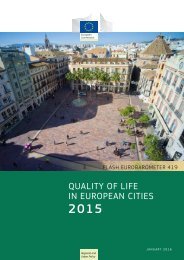Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
6222<br />
6223<br />
6224<br />
6225<br />
6226<br />
6227<br />
6228<br />
6229<br />
6230<br />
6231<br />
6232<br />
6233<br />
6234<br />
6235<br />
6236<br />
6237<br />
6238<br />
6239<br />
6240<br />
6241<br />
6242<br />
6243<br />
6244<br />
6245<br />
6246<br />
6247<br />
6248<br />
6249<br />
6250<br />
6251<br />
6252<br />
6253<br />
6254<br />
6255<br />
6256<br />
6257<br />
6258<br />
6259<br />
6260<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Um die Beschäftigungsquote zu steigern oder min<strong>des</strong>tens zu stabilisieren, muss das BIP entweder beständig im<br />
Ausmaß <strong>des</strong> Produktivitätsfortschritts steigen oder die Arbeitszeiten pro Erwerbstätigen müssen entsprechend<br />
sinken. 383<br />
3.5.2. Zur empirischen Entwicklung von Wachstum und Beschäftigung<br />
Der „Wachstumswert“ der erreicht werden muss, bevor sich das BIP positiv auf das Arbeitsvolumen und die<br />
Beschäftigung auswirkt, wird als „Beschäftigungsschwelle“ bezeichnet. 384 Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die<br />
jährlichen Wachstumsraten mit durchschnittlich über 8 Prozent (1950er Jahre) beziehungsweise dann knapp<br />
unter 5 Prozent (1960er Jahre) noch sehr hoch lagen, stieg auch die Produktivität stark an. Die<br />
Beschäftigungsschwelle lag Schätzungen zufolge bei 4 bis 5 Prozent. Mit dem kontinuierlichen Absinken der<br />
Wachstumsraten auf einen durchschnittlichen Wert von 1 Prozent in der ersten Dekade <strong>des</strong> neuen Jahrhunderts<br />
sank auch die Beschäftigungsschwelle deutlich auf unter 2 Prozent. 385<br />
Im langfristigen Verlauf zeigt sich allerdings, dass zwischen BIP- und Produktivitätsentwicklung keine feste<br />
Beziehung besteht. 386 Gleichwohl zeigen die Daten für Deutschland, dass die Produktivitätsentwicklung mit den<br />
sinkenden Wachstumsraten <strong>des</strong> BIP über die letzten Dekaden zurückgegangen ist. Allerdings lagen die<br />
Steigerungsraten der Produktivität je Erwerbstätigenstunde in der Regel über denen <strong>des</strong> BIP.<br />
Dies bedeutet, dass beständig weniger Arbeitseinsatz gebraucht wurde, um das (langsamer wachsende) jährliche<br />
BIP zu produzieren. Bei der Entwicklung <strong>des</strong> preisbereinigten BIP und <strong>des</strong> Arbeitsvolumens kam es zu einer<br />
Scherenentwicklung: Vor wie nach der deutschen Vereinigung ging das Arbeitsvolumen zurück, während das<br />
reale BIP – zwar mit abnehmenden prozentualen Zuwächsen und von konjunkturellen Entwicklungen und Krisen<br />
abgesehen – kontinuierlich wuchs. Letzteres stieg zwischen 1970 und 1990 um 67 Prozent an, während das<br />
Arbeitsvolumen im gleichen Zeitraum um gut 7 Prozent sank. Ähnlich war die Entwicklung nach der deutschen<br />
Vereinigung. Zwischen 1991 und 2008, also bis zum Beginn der großen Krise, ging das Arbeitsvolumen um<br />
4,5 Prozent zurück, während das reale BIP im gleichen Zeitraum um 28,5 Prozent stieg (vgl. Abbildung 34).<br />
Infolge der großen Krise brachen 2009 das reale BIP (minus 5,1 Prozent) und das Arbeitsvolumen (minus<br />
2,7 Prozent) deutlich ein. Nach diesem Einbruch stieg das Arbeitsvolumen 2010 und 2011 um insgesamt<br />
4 Prozent deutlich an, blieb aber aufgrund <strong>des</strong> wieder relativ hohen Produktivitätsfortschritts deutlich hinter<br />
dem Wachstum <strong>des</strong> realen BIP von 6,8 Prozent zurück.<br />
Dieser empirische Überblick macht deutlich, dass es in den letzten Dekaden in Deutschland eines laufend<br />
höheren Wirtschaftswachstums bedurft hätte, um ein sinken<strong>des</strong> Arbeitsvolumen und daraus resultierende<br />
Probleme auf dem Arbeitsmarkt zu vermeiden. Die Erklärungen für das niedrige und in der Tendenz sogar<br />
kontinuierlich sinkende Wachstum sind vielfältig. Solange die Bevölkerung in Deutschland noch zunahm, reichte<br />
das Spektrum der Erklärungen von nachfragebedingten (schwache Nachfrage wegen zurückbleibender<br />
Entwicklung der Masseneinkommen, Konzentration von Einkommen und Vermögen, zunehmenden relativen<br />
Sättigungstendenzen et cetera) bis hin zu angebotsseitigen (nachlassende Innovationstätigkeit, fehlende<br />
Investitionen wegen ungünstiger Kosten- und Steuerstruktur et cetera). Mit dem Wendepunkt bei der<br />
Bevölkerungsentwicklung von anhaltender Expansion zur Schrumpfung im Jahr 2002 kommt der<br />
zurückgehenden Bevölkerung ein wesentlicher Erklärungsansatz für sinkende Wachstumsraten zu. Die bereits<br />
vorgestellten Projektionen zeigen, dass von der zurückgehenden Bevölkerungsgröße zukünftig eine erheblich<br />
dämpfende Wirkung auf das jährliche Wachstum ausgeht, sodass die Wachstumsraten der kommenden zwei<br />
383<br />
Vgl. Herzog-Stein, Alexander; Lindner, Fabian; Sturn, Simon; van Treeck, Till (2010). Vom Krisenherd zum<br />
Wunderwerk?: insbesondere 1 ff.<br />
384<br />
Zur Vorgehensweise bei der Ermittlung der Beschäftigungsschwelle siehe beispielsweise Sachverständigenrat<br />
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2005). Die Chance nutzen – Reformen mutig<br />
voranbringen: 141-145.<br />
385<br />
Vgl. Schirwitz, Beate (2005). Wirtschaftswachstum und Beschäftigung – die Beschäftigungsschwelle.<br />
386<br />
Nicholas Kaldor hatte unter Verweis auf Arbeiten von Petrus J. Verdoorn eine allgemeine lineare<br />
Abhängigkeit von Produktivitäts- und Outputwachstum beschrieben („Verdoorn’sches Gesetz“). Vgl. Kaldor,<br />
Nicholas (1966). Causes of the Slow Growth in the United Kingdom. Verdoorn selbst musste jedoch später<br />
zugestehen, dass seit Mitte der 1960er Jahre ein eindeutiger Zusammenhang von Produktions- und<br />
Produktivitätswachstum nicht mehr empirisch zweifelsfrei nachweisbar sei. Vgl. Verdoorn, Petrus Johannes<br />
(1980). Verdoorn’s Law in Retrospect.<br />
177