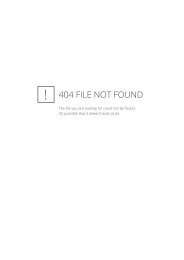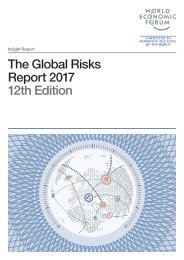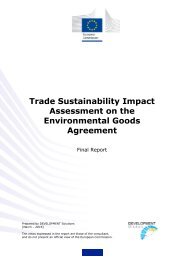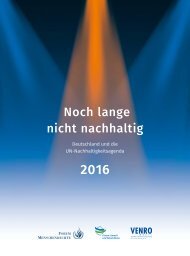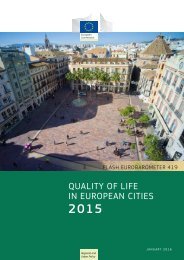Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3604<br />
3605<br />
3606<br />
3607<br />
3608<br />
3609<br />
3610<br />
3611<br />
3612<br />
3613<br />
3614<br />
3615<br />
3616<br />
3617<br />
3618<br />
3619<br />
3620<br />
3621<br />
3622<br />
3623<br />
3624<br />
3625<br />
3626<br />
3627<br />
3628<br />
3629<br />
3630<br />
3631<br />
3632<br />
3633<br />
3634<br />
3635<br />
3636<br />
3637<br />
3638<br />
3639<br />
3640<br />
3641<br />
3642<br />
3643<br />
3644<br />
3645<br />
3646<br />
3647<br />
3648<br />
3649<br />
3650<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Zunächst spricht die zeitliche Abfolge dafür, den Hauptschuldigen für den „skill bias“ beim internationalen<br />
Handel zu suchen. Technischen Fortschritt hat es nämlich seit der Industrialisierung (und schon vorher) gegeben,<br />
und er war eigentlich immer „arbeitssparend“. Gesamtwirtschaftlich war dies so lange unproblematisch, wie die<br />
freigesetzten Arbeitskräfte an anderer Stelle Arbeitsplätze fanden, die ihnen min<strong>des</strong>tens die gleiche<br />
Arbeitsproduktivität wie zuvor gewährleisteten, und zwar eben auch an modernsten Maschinen. Genau dies ist<br />
aber nicht mehr der Fall, weil ein zunehmender Teil dieser Tätigkeiten in Branchen, die besonders intensiv<br />
einfache Arbeit einsetzen, in Entwicklungs- und Schwellenländern stattfindet. In diesem Sinne trägt nicht der<br />
(schon lange wirkende) technische Fortschritt die Verantwortung, sondern die (historisch neue) Globalisierung<br />
durch den Handel mit verarbeiteten Gütern und die Verlagerungen industrieller Produktion über nationale<br />
Grenzen hinweg.<br />
Diese Erklärung – im Folgenden „Handelsthese“ genannt – ist zwar in sich schlüssig, stößt aber auf Fakten, die<br />
schwer mit ihr zu vereinbaren sind. Sie impliziert nämlich, dass der „skill bias“ besonders in jenen Branchen zu<br />
finden sein sollte, in denen die Konkurrenz aus Entwicklungs- und Schwellenländern besonders stark ausfällt. 163<br />
Empirische Untersuchungen belegen aber eindeutig, dass der „skill bias“ in allen Industriebranchen beobachtbar<br />
ist und zu rund 80 Prozent auf Trends innerhalb (und nicht zwischen) Branchen zurückgeführt werden kann.<br />
Hinzu kommt, dass nach der „Handelsthese“ auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern, mit denen der<br />
Handel betrieben wird, eine ganz spezifische Wirkung zu erwarten wäre, und zwar eine Art „unskill bias“, das<br />
heißt eine verstärkte Nachfrage nach einfacher Arbeit in den Exportbranchen. Auch dies ist nicht der Fall.<br />
Empirische Studien für eine Reihe von Ländern zeigen, dass es – entgegen der „Handelsthese“ – auch dort einen<br />
„skill bias“ gibt.<br />
Die Entwicklung ist also überall ziemlich parallel verlaufen, was eher für eine branchenübergreifende, globale<br />
Veränderung <strong>des</strong> technologischen Trends als für den Handel als Hauptursache spricht. Diese „Technikthese“ (als<br />
Alternative zur „Handelsthese“) könnte etwa wie folgt lauten: Irgendwann ab den frühen 1980er Jahren sorgte<br />
die tief greifende Veränderung der Informationstechnologien quer durch Branchen und Länder für ein verstärktes<br />
„Wegrationalisieren“ von einfacher Arbeit, sei es in den verschiedenen Industrien oder auch bei<br />
Dienstleistungen. Symbole dafür sind nicht nur voll automatisierte, computergesteuerte Produktionslinien in der<br />
Industrie, sondern auch der Einsatz von Scannern an den Kassen der Supermärkte <strong>des</strong> Einzelhandels. Hier<br />
könnte es durchaus einen Bruch mit der Vergangenheit gegeben haben: Eine neue „general purpose technology“,<br />
also eine Technologie, die praktisch alle Produktionsprozesse durchdringt, begann die Knappheitsverhältnisse<br />
am Arbeitsmarkt grundlegend zu verändern. 164<br />
So weit eine Art modifizierte „Technikthese“. Als vollwertige Alternativerklärung zur „Handelsthese“ wird ihr<br />
allerdings zunehmend widersprochen, und zwar mit Blick auf neue Trends. So hat sich die Art <strong>des</strong> Handels<br />
zwischen Industrie- und Entwicklungsländern verändert. Die eigentliche Wachstumsdynamik kommt aus dem<br />
Handel innerhalb von Industrien, und zwar unter anderem durch zunehmende Auslagerung von<br />
Produktionsstufen („Outsourcing“ und „Offshoring“). Wenn dem so ist, so führen internationale<br />
Produktionsverlagerungen der jeweils arbeitsintensivsten Stufen der Wertschöpfungskette im Industrieland zu<br />
einem allgemeinen „skill bias“, im Entwicklungsland aber möglicherweise ebenso, weil die Produktionsstufe im<br />
dortigen Umfeld stärker qualifizierte als einfache Arbeit einsetzt. So wird dann auch wieder die „Handelsthese“<br />
mit den beobachteten Phänomenen vereinbar.<br />
So weit in Grundzügen die Kontroverse. Sie hat noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis geführt. Für die<br />
Vereinigten Staaten hat es zwar empirische Versuche gegeben, den „skill bias“ präzise zu messen und<br />
ökonometrisch auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Im Ergebnis wird dem Handel dabei in der Regel<br />
maximal 20 Prozent für die Erklärung <strong>des</strong> „skill bias“ zugesprochen; der technische Fortschritt als Ursache<br />
dominiert also derzeit noch das Bild. Inwieweit allerdings diese Ergebnisse lange Bestand haben werden, bleibt<br />
abzuwarten. Zweifel sind angebracht, und zwar vor allem aus zwei Gründen. Zum einen setzt sich der Trend<br />
zum intra-industriellen Handel zwischen Industrie- und Entwicklungsländern zügig fort. Outsourcing und<br />
Offshoring werden <strong>des</strong>halb zu immer bedeutsameren Phänomenen. Es entstehen dann in praktisch allen<br />
163<br />
Streng genommen müssten andere Branchen sogar eine gegenläufige Tendenz aufweisen, denn einfache<br />
Arbeit wird in Industrieländern billiger, und es lohnt sich <strong>des</strong>halb, mehr davon einzusetzen.<br />
164<br />
Ganz ähnlich tat dies in den 1920er Jahren das Fließband, allerdings mit genau gegenläufiger Richtung, weil<br />
damals durch die Zerlegung <strong>des</strong> Arbeitsablaufs in kleinste triviale Schritte plötzlich auch eine völlig<br />
unqualifizierte Arbeitskraft (zum Beispiel eine Analphabetin oder ein Analphabet) eine hohe<br />
Arbeitsproduktivität erzielen konnte. In der Tat ist es ja vielleicht kein Zufall, dass gerade in dieser Zeit ein<br />
Trend zur Angleichung der Einkommensverteilung zu beobachten war (siehe oben im Text in Teil B3.6.1 dieses<br />
Abschnitts).<br />
98