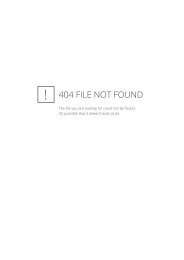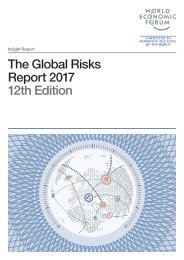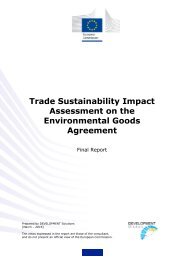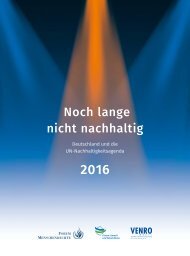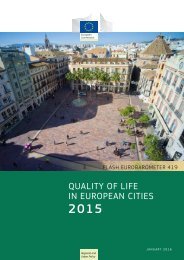Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
4767<br />
4768<br />
4769<br />
4770<br />
4771<br />
4772<br />
4773<br />
4774<br />
4775<br />
4776<br />
4777<br />
4778<br />
4779<br />
4780<br />
4781<br />
4782<br />
4783<br />
4784<br />
4785<br />
4786<br />
4787<br />
4788<br />
4789<br />
4790<br />
4791<br />
4792<br />
4793<br />
4794<br />
4795<br />
4796<br />
4797<br />
4798<br />
4799<br />
4800<br />
4801<br />
4802<br />
4803<br />
4804<br />
4805<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
1. Es überwiegt ein Verständnis, das von der Ambivalenz der Moderne ausgeht, die immer wieder durch<br />
politische Rahmensetzungen einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Entwicklungen braucht.<br />
Beispielhaft hat Ralf Dahrendorf das im Begriffspaar „Verlust an Bindungen/Ligaturen“ und „Gewinn<br />
an Optionen“ herausgearbeitet. Es beschreibt die gesteigerte individuelle Selbstverfügbarkeit,<br />
Selbstbezüglichkeit und Selbsteinwirkungsmöglichkeit der Moderne, denen eine schwindende soziale und<br />
kulturelle Bindung an die Gesellschaft entgegensteht. 224<br />
2. Die Gesellschaft vermag immer weniger als Ganze auf sich einzuwirken. Auch die Politik tut sich schwer,<br />
die Ganzheit zu repräsentieren. Daraus ergibt sich eine Schwächung in der politischen Steuerung und<br />
Gestaltung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse. 225<br />
3. Von zentraler Bedeutung ist das Verhältnis zwischen Wirtschaftssystem und natürlicher Mitwelt, weil sich<br />
die bisherige technisch-ökonomische Entwicklung überwiegend durch den Verzehr der natürlichen<br />
Ressourcen reproduziert, zu deren Erhalt sie wenig beiträgt. 226<br />
4. Zentrale Probleme müssen als Folgeprobleme der Errungenschaften der Moderne identifiziert werden,<br />
wobei die Folgekosten den Nutzen übersteigen können. 227 Denn die Möglichkeit, Probleme durch eine<br />
immer weitere Ausdifferenzierung zu bewältigen, gerät an Grenzen.<br />
5. Die „Weltrisikogesellschaft” potenziert in neuen und komplexen Formen die Herausforderung an<br />
politische Steuerung, soziale Kompatibilität und gesellschaftliche Koordination. 228<br />
Neben den angedeuteten Schwachstellen und Fehlern der europäischen Moderne, in der vor allem technischer<br />
Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum zum Selbstzweck wurden, obwohl sie ursprünglich als Wege zur<br />
Verwirklichung von Emanzipation und Freiheit verstanden wurden, sind der soziale Wandel, die ökologischen<br />
Herausforderungen und die ökonomischen Umbrüche entscheidende Gründe, um die Notwendigkeit der sozialökologischen<br />
Transformation zu beschreiben. Dabei knüpfen wir an die Theorie <strong>des</strong> Wiener<br />
Wirtschaftsanthropologen Karl Polanyi an, der 1944 die Entbettungsprozesse hin zu einer Marktgesellschaft in<br />
seiner Langfriststudie als „The Great Transformation“ beschrieben hat. 229<br />
Anders als bei Polanyi, der die Transformation – zeitgemäß verständlich – für den Nationalstaat und die soziale<br />
Frage beschrieben hat, müssen wir heute nicht nur die soziale, sondern auch die ökologische Entbettung sehen<br />
und von globalen und kosmopolitischen Zusammenhängen ausgehen. 230<br />
1.3. Die Wiederkehr der Wachstumsdebatte<br />
Die multiplen Krisen der Gegenwart haben ihre entscheidende Ursache in einer tiefgreifenden Erschöpfung <strong>des</strong><br />
derzeitigen Wirtschaftens. Die Stimmen derer, die die Wachstumsorientierung und Wachstumsabhängigkeit<br />
unserer Wirtschaftsweise und Gesellschaftsformation kritisch hinterfragen, werden lauter.<br />
Schon 1968 hatte der Richta-Report der Prager Akademie der Wissenschaften 231 und 1972 der Club of Rome 232<br />
die Grenzen <strong>des</strong> Wachstums und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch sowie die<br />
Frage von Wohlstand und Lebensqualität thematisiert. Nicht nur die Umweltgrenzen, auch die sozialen<br />
Schranken <strong>des</strong> Wachstums durch Konsumsättigung und Statusgüter wurden später Gegenstand kritischer<br />
Debatten. 233 Zu den Zweifeln an der prinzipiellen sozialen, vor allem an der ökologischen Verträglichkeit <strong>des</strong><br />
wirtschaftlichen Wachstums gesellten sich die Erfahrungen mit den Folgeproblemen stark ungleicher<br />
Industriegesellschaften. Zudem haben die Erkenntnisse der Glücksforschung die Annahme relativiert, dass die<br />
stetige Zunahme von Einkommen und materiellen Besitztümern in gleichem Maße zu einer höheren individuellen<br />
224<br />
Vgl. Dahrendorf, Ralf (1979). Lebenschancen.<br />
225<br />
Vgl. Luhmann, Niklas (1984). Soziale Systeme.<br />
226<br />
Vgl. WWF (2012). Living Planet Report.<br />
227<br />
Vgl. Sen, Amartya (1990). Der Lebensstandard.<br />
228<br />
Vgl. Beck, Ulrich (2007). Weltrisikogesellschaft.<br />
229<br />
Vgl. Polanyi, Karl (1944). The Great Transformation.<br />
230<br />
Vgl. Beck (2007).<br />
231<br />
Vgl. Richta, Radovan et al. (1968). Zivilisation am Scheideweg.<br />
232<br />
Vgl. Meadows, Dennis; Meadows, Donella H.; Zahn, Erich (1972). Die Grenzen <strong>des</strong> Wachstums.<br />
233<br />
Vgl. Hirsch, Fred (1980). Die sozialen Grenzen <strong>des</strong> Wachstums.<br />
134