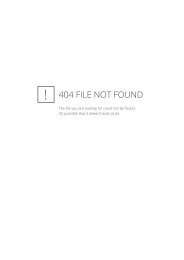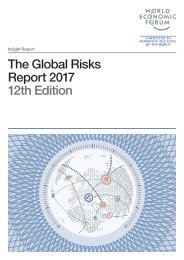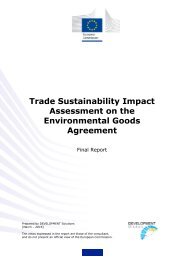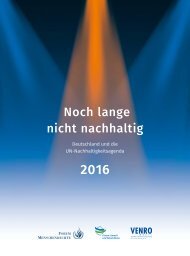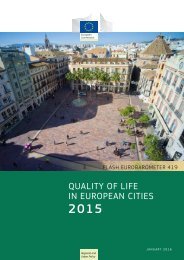Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2283<br />
2284<br />
2285<br />
2286<br />
2287<br />
2288<br />
2289<br />
2290<br />
2291<br />
2292<br />
2293<br />
2294<br />
2295<br />
2296<br />
2297<br />
2298<br />
2299<br />
2300<br />
2301<br />
2302<br />
2303<br />
2304<br />
2305<br />
2306<br />
2307<br />
2308<br />
2309<br />
2310<br />
2311<br />
2312<br />
2313<br />
2314<br />
2315<br />
2316<br />
2317<br />
2318<br />
2319<br />
2320<br />
2321<br />
2322<br />
2323<br />
2324<br />
2325<br />
2326<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
reintegrierbarer, vor allem älterer Langzeitarbeitsloser, der sich vor allem aus vormaligen Industriearbeiterinnen<br />
und Industriearbeitern bestand.<br />
Die Wachstumsleistung der deutschen Volkswirtschaft nahm in dieser Zeit im Trend ab. Das BIP wuchs im<br />
jährlichen Durchschnitt mit 2,2 Prozent (1973-80) und 1,9 Prozent (1980-89), weit weniger als die 4,4 Prozent in<br />
der Zeit der Überbeschäftigung 1960-73. Ähnliches gilt für die Arbeitsproduktivität, die jährliche<br />
Steigerungsraten von 3,2 Prozent (1973-80) und 2,2 Prozent (1980-89) aufwies, gleichfalls deutlich weniger als<br />
die 5,2 Prozent in der Zeit 1960-73. Es wurde intensiv darüber diskutiert, auf welche Ursachen die beobachtete<br />
„Wachstumsmalaise“ zurückzuführen sein könnte. 34 In der historischen Rückschau war die Verlangsamung <strong>des</strong><br />
Wachstums nichts anderes als eine Normalisierung: Mit Steigerungsraten von noch über zwei Prozent pro Jahr<br />
lag der Fortschritt der Arbeitsproduktivität noch immer über dem, was im langfristigen Durchschnitt der<br />
Industrienationen seit Mitte <strong>des</strong> 19. Jahrhunderts zu beobachten ist. 35 Es ging also eigentlich gar nicht um eine<br />
außergewöhnliche Wachstumsschwäche, sondern um eine Art Ausklingen <strong>des</strong> Nachkriegsbooms, also das Ende<br />
einer außergewöhnlichen Wachstumsstärke. 36<br />
Gleichwohl bleibt die Frage, wo die Gründe für dieses Ende lagen. Vieles spricht dafür, dass die<br />
Wachstumskräfte der Zeit bis 1973 an jene (temporären) Grenzen stießen, die sich durch die globale<br />
Verfügbarkeit von Ressourcen und die lokale Belastung der Umwelt ergaben. Tatsächlich induzierten die<br />
massive Verteuerung der Rohstoffe sowie die zunehmende Bepreisung der lokalen Umwelt durch staatliche<br />
Regulierung einen umfassenden Prozess der Erneuerung <strong>des</strong> industriellen Kapitalbestands, und zwar in Richtung<br />
auf ressourcen- und umweltschonende Technologien. Dieser Strukturwandel war teuer und kompliziert, und er<br />
erforderte eine neue industrielle Innovationskraft, die erst Schritt für Schritt aufgebaut werden musste. Hinzu<br />
kam die Herausforderung der damals aufkommenden Mikroelektronik, die als neuartige „general purpose<br />
technology“ 37 praktisch die gesamte Wirtschaft durchdrang und fast flächendeckend zu neuartigen, noch<br />
unerprobten Arbeitsteilungen und -prozessen führte. Es kann nicht verwundern, dass dabei der<br />
Produktivitätsfortschritt gesamtwirtschaftlich langsamer verlief als noch im „Aufholwachstum“ der 1950er und<br />
1960er Jahre, das in eher vertrauten industriellen und technologischen Bahnen verlief. Im Vordergrund stand<br />
eben nicht mehr ein „quantitatives“ Wachstum, sondern vielmehr ein „qualitatives“ Wachstum als Antwort auf<br />
den Strukturwandel.<br />
Die „Wachstumsmalaise“ Deutschlands – und im Übrigen fast aller westlichen Industrienationen mit<br />
marktwirtschaftlicher Ordnung – wurde seinerzeit als Krise wahrgenommen. Im Nachhinein ist aber klar, dass es<br />
sich um einen letztlich unvermeidbaren Strukturwandel handelte. Dies lässt sich am Schicksal der mittel- und<br />
osteuropäischen Länder erkennen, die genau diesen Wandel nicht mitmachten. Ihr Rückstand in Bezug auf<br />
industrielle Effizienz und Modernität war zwar schon in den frühen 1970er Jahre deutlich erkennbar; er gewann<br />
aber erst dann eine völlig neue Dimension, als sich die sozialistisch gelenkten Planwirtschaften als völlig unfähig<br />
erwiesen, die Herausforderung höherer Energie- und Rohstoffpreise durch eine radikale Neuorientierung in eine<br />
ressourcensparende ökologische Richtung überhaupt anzunehmen. 38 Nach dem Mauerfall zeigte sich im Osten<br />
Deutschlands exemplarisch, wie katastrophal der Zustand <strong>des</strong> Maschinenparks in der planwirtschaftlichen<br />
Industrie war. Gerade die massive Verschwendung von Energie sowie die rücksichtslose Zerstörung der Umwelt<br />
durch die Emissionen großindustrieller Anlagen erwiesen sich als Haupthindernisse auf dem Weg zum<br />
Wiedergewinn der Wettbewerbsfähigkeit unter marktwirtschaftlichen Bedingungen.<br />
3.1.4 1989-2005: Wachstumskrise II: Aufbau Ost und Globalisierung<br />
Nicht nur politisch bildet die turbulente Zeit vom Mauerfall im November 1989 bis zum politischen Abschluss<br />
der deutschen Einheit im Oktober 1990 eine Zäsur. Auch wirtschaftlich beginnt zu dieser Zeit mit dem Aufbau<br />
Ost, der Öffnung Mittel- und Osteuropas sowie der verstärkten Integration der großen Entwicklungsländer der<br />
Welt (China, Indien und andere) eine Phase neuer Herausforderungen. Was die deutsche Einheit betrifft, wurden<br />
34<br />
Ein kleinerer Teil der Ökonominnen und Ökonomen sah in der „Wachstumsmalaise“ selbstverschuldete Fehler<br />
einer zu abrupt kontraktiven Geld- und Fiskalpolitik, die schwere Rezessionen provoziert und einen dauerhaften<br />
Schaden hinterlassen hatte; ein größerer Teil glaubte, angebotsbedingte Wachstumsschwächen der deutschen<br />
Wirtschaft zu erkennen. Zu den unterschiedlichen Positionen, siehe Giersch, Herbert; Paqué, Karl-Heinz;<br />
Schmieding, Holger (1994). The Fading Miracle: Kapitel 5.<br />
35<br />
Siehe dazu Maddison, Angus (2003). The World Economy.<br />
36<br />
Dies ist die zentrale Schlussfolgerung <strong>des</strong> CEPR-Projektes zum Wachstum der 1950er bis 1980er Jahre, das<br />
den Beiträgen in Crafts; Toniolo (1996) zugrunde liegt.<br />
37<br />
Vgl. Helpman, Elhanan (Hrsg.) (1998). General Purpose Technologies and Economic Growth.<br />
38<br />
Dazu exemplarisch am Fall der DDR: Steiner, André (2004). Von Plan zu Plan.<br />
58