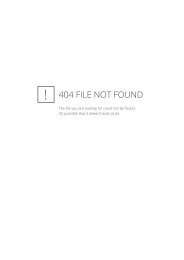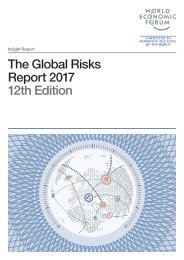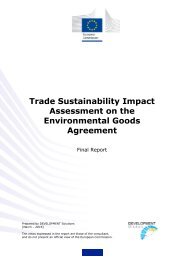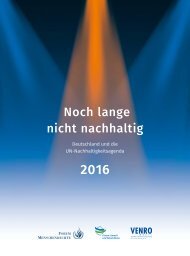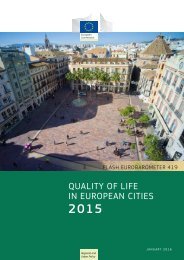Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
10368<br />
10369<br />
10370<br />
10371<br />
10372<br />
10373<br />
10374<br />
10375<br />
10376<br />
10377<br />
10378<br />
10379<br />
10380<br />
10381<br />
10382<br />
10383<br />
10384<br />
10385<br />
10386<br />
10387<br />
10388<br />
10389<br />
10390<br />
10391<br />
10392<br />
10393<br />
10394<br />
10395<br />
10396<br />
10397<br />
10398<br />
10399<br />
10400<br />
10401<br />
10402<br />
10403<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil C: Projektgruppe 2<br />
Das Konstrukt „globaler Hektar“ für bioproduktive Flächen und Biokapazität abstrahiert von der realen<br />
Flächennutzung.<br />
Nicht erneuerbare Ressourcen, Wasser, „unproduktive“ Flächen (wo aber möglicherweise ein hohes<br />
Maß wertvoller Artenvielfalt herrscht) werden in die Analyse nicht mit einbezogen.<br />
Aufgrund dieser Begrenzungen ist der ökologische Fußabdruck ungeeignet unter anderem für die<br />
Indikation von Biodiversität, als Maß für die Erhaltung von Ökosystemen oder als Grundlage für ein<br />
nationales Ressourcenmanagement.<br />
Darüber hinaus scheinen problematische politische Schlussfolgerungen bei Vorliegen eines<br />
ökologischen Defizits denkbar: So könnte beispielsweise eine grundsätzlich erwünschte Erhöhung der<br />
Biokapazität durch eine Intensivierung der Landwirtschaft anstatt durch einen verminderten<br />
Ressourceneinsatz erreicht werden.<br />
Eine Nutzung <strong>des</strong> ökologischen Fußabdrucks als Leitindikator im Indikatorensatz der Enquete-Kommission<br />
würde min<strong>des</strong>tens die folgenden Weiterentwicklungen voraussetzen:<br />
Eine Verbesserung der teils unsicheren Datengrundlagen und der Transparenz: Ein Datenabgleich mit<br />
nationalen Statistiken, eine Fehlerüberprüfung, die Korrektur von Schätzungen, Überprüfung von<br />
Hypothesen sowie höhere Detaildichte von Handelsdaten wären wünschenswert, um die Solidität <strong>des</strong><br />
Indikators für Zwecke der politischen Steuerung zu erhöhen.<br />
Im Bereich methodischer Weiterentwicklungen wäre eine stärkere Anbindung an bestehende<br />
Umweltrechensysteme mit ihren Materialflussdaten, beispielsweise die Umweltökonomische<br />
Gesamtrechnung <strong>des</strong> Statistischen Bun<strong>des</strong>amtes, wünschenswert.<br />
Hinsichtlich globaler Verflechtungen sollte eine stärkere Berücksichtigung <strong>des</strong> Herkunfts- und <strong>des</strong><br />
Bestimmungslan<strong>des</strong> von Handelsgütern stattfinden.<br />
Anstelle globaler Koeffizienten sollten für den indirekten Energieeinsatz bei Importgütern für das<br />
jeweilige Produkt spezifische Koeffizienten verwandt werden.<br />
Insgesamt schätzt die Enquete-Kommission die Idee <strong>des</strong> ökologischen Fußabdrucks und empfiehlt <strong>des</strong>wegen<br />
eine Weiterentwicklung dieses intuitiv einleuchtenden, auf den ersten Blick weltweit vergleichbaren Indikators.<br />
Zugleich stellt sie jedoch fest, dass der Indikator zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Vielzahl methodischer, aber<br />
auch konzeptioneller Schwächen aufweist, sodass eine Aufnahme in einen amtlichen Indikatorensatz mehr<br />
Nachteile als Vorteile mit sich brächte.<br />
Die globalen Umweltgrenzen nach Rockström et al. (2009)<br />
Das andere von der Enquete-Kommission untersuchte Konzept setzt an beim von Rockström et al. definierten<br />
globalen Umweltraum. 674 Dieser Ansatz ist unter anderem auch von der OECD und dem Wissenschaftlichen<br />
Beirat für globale Umweltveränderungen (WBGU) verwandt worden. Er stellt einen geeigneten Rahmen zur<br />
systematischen Untersuchung unterschiedlicher Dimensionen der Ökologie dar. Ergebnisse und Messwerte der<br />
ökologischen Forschung werden dabei entsprechend den jeweils betroffenen biophysikalischen Erdprozessen<br />
ausgewiesen. 675<br />
674<br />
Der Ansatz der globalen Umweltgrenzen wurde von 29 führenden Umwelt- und Klimawissenschaftlern<br />
erarbeitet und als wissenschaftlicher Beitrag unter der Überschrift „Planetary Boundaries: Exploring the Safe<br />
Operating Space for Humanity“ in der Fachzeitschrift „Ecology and Society“ veröffentlicht. Vgl. Rockström,<br />
Johan et al. (2009). Planetary Boundaries. Dieser Beitrag bildete die Grundlage für eine in der<br />
naturwissenschaftlichen Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlichte Kurzfassung. Vgl. Rockström, Johan et al.<br />
(2009). A Safe Operating Space for Humanity. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die<br />
Quellenverweise im Text auf diese Kurzfassung.<br />
675<br />
Diese Erdprozesse sind (1) Klimawandel, (2) Übersäuerung der Ozeane, (3) Vernichtung der Ozon-Schicht,<br />
(4) Stickstoff-Zyklus, (5) Phosphor-Zyklus, (6) Frischwasser-Nutzung, (7) Landnutzungsmuster, (8) Verlust von<br />
Biodiversität, (9) Aerosole in der Atmosphäre, (10) Chemische Verschmutzung; vgl. die ausführliche<br />
Darstellung dieses Konzepts im Kapitel 1.4.4 Begrenzungen <strong>des</strong> „Umweltraums“ im Berichtsteil der<br />
Projektgruppe 3.<br />
300