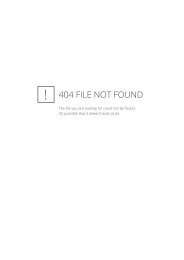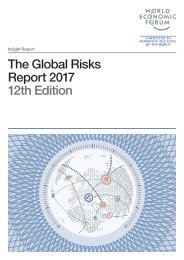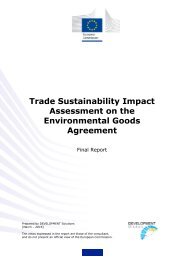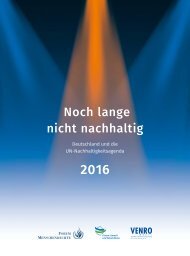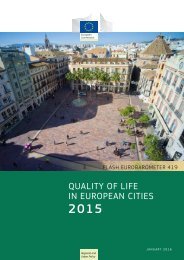Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4397<br />
4398<br />
4399<br />
4400<br />
4401<br />
4402<br />
4403<br />
4404<br />
4405<br />
4406<br />
4407<br />
4408<br />
4409<br />
4410<br />
4411<br />
4412<br />
4413<br />
4414<br />
4415<br />
4416<br />
4417<br />
4418<br />
4419<br />
4420<br />
4421<br />
4422<br />
4423<br />
4424<br />
4425<br />
4426<br />
4427<br />
4428<br />
4429<br />
4430<br />
4431<br />
4432<br />
4433<br />
4434<br />
4435<br />
4436<br />
4437<br />
4438<br />
4439<br />
4440<br />
4441<br />
4442<br />
4443<br />
4444<br />
4445<br />
4446<br />
4447<br />
4448<br />
4449<br />
4450<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Organisationsentwicklung, die effiziente und umweltschonende Produktion unter Einhaltung von<br />
Arbeitnehmerrechten sowie die Konzentrierung auf langfristige Geschäftsmodelle, kurzum: eine ökonomisch,<br />
ökologisch und sozial nachhaltige Geschäftspolitik.<br />
Kapitel 3.5 beleuchtet die Wechselbeziehung von wirtschaftlichem Wachstum und Beschäftigung. Ein direkter<br />
Zusammenhang zwischen hohen Wachstumsraten und hoher Beschäftigung kann dabei nicht nachgewiesen<br />
werden, wohl aber steigen mit den Wachstumsraten die Reallöhne. Allerdings profitieren von dieser<br />
Entwicklung nicht alle Erwerbspersonen in gleichem Maße. Ein kurzer Abriss der Beschäftigungsentwicklung<br />
zeigt, dass sich dieser Trend auch in Deutschland vollzogen hat. Erst mit der Vergrößerung <strong>des</strong> Abstands<br />
zwischen Beschäftigungslohn und Transferleistungen im Zuge der Gesetze für moderne Dienstleistungen am<br />
Arbeitsmarkt trat eine Situation ein, die dazu führte, dass auch Geringqualifizierte wieder in nennenswertem<br />
Umfang in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden konnten. Dies führte zunächst zu einem Anstieg<br />
beispielsweise bei Minijobs oder geförderter Selbstständigkeit. Dieser Trend kehrte sich allerdings um, als die<br />
Reformen schließlich auf dem Arbeitsmarkt griffen, sodass heute rund 2,5 Millionen Menschen mehr einer<br />
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen als 2005.<br />
Kapitel 3.6 geht auf den Einfluss von Wachstum auf die Einkommensverteilung ein. Hierbei zeigt sich, dass es<br />
seit Beginn der Industrialisierung tatschlich eine massive Spreizung der Einkommensverteilung gegeben hat.<br />
Allerdings fällt der Großteil dieser Entwicklung in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und damit in die<br />
Pionierzeit der Industrialisierung. Seit den 1960er Jahren steigt die Spreizung dagegen nur noch sehr moderat<br />
und ist in den Industrieländern zu großen Teilen auf die Abnahme der Haushaltsgrößen zurückzuführen. Zudem<br />
ist in der Einkommensverteilung ein sogenannter „skill bias“ festzustellen, also eine systematisch höhere<br />
Bewertung höher qualifizierter Arbeit gegenüber niedriger qualifizierter Arbeit. Auch der demografische Wandel<br />
spielt eine Rolle für die Einkommensverteilung – jedoch weitaus weniger signifikant als für die wirtschaftliche<br />
Entwicklung insgesamt sowie für öffentliche Finanzen. Diese Zusammenhänge werden in den Kapiteln 4.1 und<br />
4.2 thematisiert.<br />
In Kapitel 4.1 wird die Rolle <strong>des</strong> demografischen Wandels für die zukünftige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit<br />
Deutschlands aufgegriffen. Dabei werden drei Wege identifiziert, um die Innovationskraft auch unter dem<br />
Eindruck einer Verhältnisverschiebung zwischen Jung und Alt zu erhalten: bessere Ausbildung, bessere<br />
Arbeitsteilung und bessere Lenkung. Bessere Bildung lohnt sich dabei sowohl für den Einzelnen (in Form<br />
höherer Einkommen) als auch gesamtwirtschaftlich (in Form höherer Innovationskraft). Es ist jedoch fraglich, ob<br />
rein quantitative Verbesserungen die Bildung in Deutschland beim bereits gegebenen hohen Stand noch weiter<br />
verbessern können. Vielmehr sind hier eher qualitative Verbesserungen gefragt. Eine bessere Arbeitsteilung<br />
bedeutet letztlich eine noch konsequentere Teilung sogenannter "fluider“ und „kristalliner“ Aufgaben. Letztere<br />
werden aufgrund ihrer erhöhten Anforderungen an Routine und Erfahrung eher Älteren zugedacht, erstere<br />
aufgrund ihrer Anforderungen an Innovationskraft und Originalität dagegen eher Jüngeren. Die Entlastung<br />
innovativer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von rein administrativen Aufgaben ist aber generell ein<br />
entscheidender Schlüssel zum Erhalt der Innovationskraft und manifestiert sich weniger an der Trennlinie<br />
zwischen Jung und Alt.<br />
Grundsätzlich hält der demografische Wandel Chancen und Risiken gleichermaßen bereit. So dürfte das eben<br />
dargestellte Erfordernis an noch bessere Arbeitsteilung die Nachfrage auch nach Arbeitnehmerinnen und<br />
Arbeitnehmern jenseits der 60 (sofern sie die entsprechenden Qualifikationen aufweisen) deutlich steigern und<br />
die Frühverrentungspolitik der vergangenen Jahre endgültig beenden. Allerdings ergeben sich besonders für die<br />
öffentlichen Finanzen und hier insbesondere für die gesetzliche Renten- und Krankenversicherung erhebliche<br />
Risiken, wie in Kapitel 4.2 herausgestellt wird. Die Tragfähigkeitslücke der gesamtstaatlichen Finanzen beträgt<br />
nach aktuellen Prognosen dauerhaft rund 3,1 Prozent <strong>des</strong> BIP, was letztlich bedeutet, dass der Saldo aus<br />
staatlichen Einnahmen und Ausgaben dauerhaft um 3,1 Prozent <strong>des</strong> BIP erhöht werden muss, um eine dauerhafte<br />
Tragfähigkeit zu gewährleisten.<br />
Allerdings können bereits recht marginale Zuwächse bei Geburtenrate und Zuwanderung diese Entwicklung<br />
erheblich positiver ausfallen lassen. Hierzu tragen nicht zuletzt die steuerfinanzierten öffentlichen Haushalte bei,<br />
bei denen sich die Situation durch den demografischen Wandel aufgrund der sogenannten demografischen<br />
Dividende (also Einsparungen durch nicht mehr benötigte Ausgaben beispielsweise für den<br />
Familienlastenausgleich<br />
Sicherungssystemen.<br />
oder Schulen) deutlich weniger verschärft als in den großen sozialen<br />
Kapitel 4.3 gibt schließlich noch einen Überblick über die Herausforderungen für deutsche Unternehmen in einer<br />
globalisierten Welt. Es zeigt sich, dass deutsche Unternehmen die Herausforderungen der wirtschaftlichen<br />
117