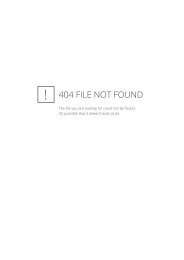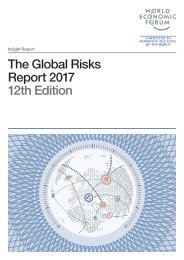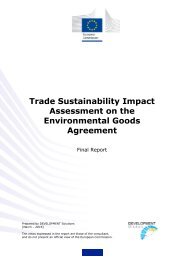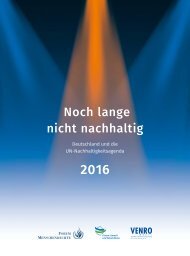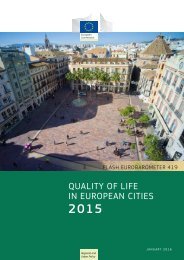Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
3159<br />
3160<br />
3161<br />
3162<br />
3163<br />
3164<br />
3165<br />
3166<br />
3167<br />
3168<br />
3169<br />
3170<br />
3171<br />
3172<br />
3173<br />
3174<br />
3175<br />
3176<br />
3177<br />
3178<br />
3179<br />
3180<br />
3181<br />
3182<br />
3183<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Arbeit Produktion und Einkommen erzielt, während Arbeitslosigkeit gesellschaftliche Kosten verursacht. Zum<br />
anderen sind Arbeit und Beschäftigung wichtige Aspekte <strong>des</strong> materiellen Wohlstands, der sich auf das<br />
Wohlbefinden der einzelnen Menschen auswirkt. 119 Empirische Studien belegen, dass das subjektive<br />
Wohlbefinden von Erwerbslosen niedriger ist als das von – ansonsten vergleichbaren – Beschäftigten. 120 Darüber<br />
hinaus senkt zunehmende Arbeitslosigkeit das Wohlbefinden auch von Personen, die nicht direkt betroffen sind,<br />
da Arbeitslosigkeit Ausdruck steigender wirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit ist. 121 Arbeitslosigkeit macht<br />
also unglücklich, Beschäftigung führt zu individuellem Wohlbefinden und gesamtwirtschaftlichem Wohlstand.<br />
Dies wirft die Frage auf, wie ein hohes Beschäftigungsniveau erreicht werden kann und ob dieses Ziel bedroht<br />
wäre, wenn das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft langfristig geringer ausfallen sollte als bisher.<br />
3.5.1 Zum Zusammenhang von Wachstum und Beschäftigung<br />
Konjunkturelle Schwankungen der gesamtwirtschaftlichen Produktion haben typischerweise erhebliche<br />
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. So geht ein Abschwung in der Regel mit rückläufiger Beschäftigung und<br />
steigender Arbeitslosigkeit einher. Hierfür ist – neben realwirtschaftlichen Anpassungsfriktionen 122 – auch die<br />
kurzfristige Rigidität von Preisen und Löhnen verantwortlich, die einen schnellen Ausgleich von Arbeitsangebot<br />
und Arbeitsnachfrage verhindert.<br />
Jenseits konjunktureller Zyklen besteht jedoch kein allgemeingültiger Zusammenhang zwischen der<br />
Beschäftigung und dem Niveau oder dem Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung. Dies wird gestützt durch die<br />
Beobachtung, dass deutlich ärmere Länder als Deutschland nicht unbedingt eine höhere Arbeitslosenrate<br />
aufweisen. Als entscheidender Mechanismus für den Ausgleich von Arbeitsangebot und -nachfrage fungiert der<br />
Reallohn, das heißt der Lohnsatz in Relation zum Preisniveau. 123 Bei Unterbeschäftigung entsteht ein Druck auf<br />
den Reallohn, der daraufhin allmählich zu sinken beginnt. Dies reduziert zum einen das Arbeitsangebot der<br />
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 124 Zum anderen stimuliert es die Arbeitsnachfrage der Unternehmen.<br />
Denn die Unternehmen fragen nur diejenige Menge an Arbeit nach, deren Ertrag min<strong>des</strong>tens die Lohnkosten<br />
deckt. Bei gegebener Produktivität steigt die Arbeitsnachfrage daher mit sinkendem Reallohn, da mehr<br />
Arbeitsplätze rentabel werden. Empirische Studien belegen diese negative Arbeitsnachfrageelastizität. 125<br />
119<br />
Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung; Conseil d’Analyse<br />
Économique (2010). Wirtschaftsleistung, Lebensqualität und Nachhaltigkeit.<br />
120<br />
Dies bedeutet, dass der Verlust an Wohlbefinden über das Maß hinausgeht, das durch die indirekten<br />
negativen Effekte der Erwerbslosigkeit wie den Einkommensverlust erklärt werden kann.<br />
121<br />
Vgl. Frey, Bruno S.; Stutzer, Alois (2002). The Economics of Happiness.<br />
122<br />
Realwirtschaftliche Anpassungsfriktionen entstehen zum Beispiel daraus, dass von einer Rezession nicht alle<br />
Firmen gleichermaßen betroffen sind. Selbst bei flexiblen Löhnen würden einige Unternehmen ihre<br />
Mitarbeiterzahl verringern, andere dagegen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Doch es dauert<br />
einige Zeit, bis offene Stellen sowie Bewerberinnen und Bewerber „zueinander finden“, zumal die<br />
Qualifikationsmuster nicht immer zueinanderpassen.<br />
123<br />
Die folgenden Ausführungen stützen sich insbesondere auf Franz, Wolfgang (2009). Arbeitsmarktökonomik<br />
sowie auf den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2006).<br />
Arbeitslosengeld II reformieren.<br />
124<br />
Ausgehend von einer Reallohnerhöhung wird das Arbeitsangebot für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br />
durch zwei gegensätzliche Effekte beeinflusst. Ein Lohnanstieg verteuert für Individuen zum einen die Freizeit<br />
relativ zur Verwendung als Arbeitszeit und führt zu einer Ausweitung <strong>des</strong> Arbeitsangebots (Substitutionseffekt).<br />
Bei einem insgesamt höheren Einkommen können sich Individuen zum anderen aber auch für mehr Freizeit<br />
entscheiden, wenn sie sich mit einem bestimmten Einkommen zufriedengeben (Einkommenseffekt). Empirisch<br />
betrachtet überwiegt generell der Substitutionseffekt, das heißt, das Arbeitsangebot steigt mit höherem Lohn.<br />
Siehe Franz (2009): 70 ff. für einen Überblick über die empirischen Studien.<br />
125<br />
Hansen (1978) zeigt, dass ein Anstieg der Arbeitskosten im verarbeitenden Gewerbe Westdeutschlands um<br />
1 Prozent langfristig zu einem Rückgang der Arbeitsnachfrage um 0,5 Prozent führt. Vgl. Hansen, Gerd (1978).<br />
Der Einfluss der Lohnkosten auf die Arbeitsnachfrage <strong>des</strong> verarbeitenden Gewerbes. Franz und König (1986)<br />
schätzen den Effekt, ebenfalls für das verarbeitende Gewerbe, auf rund -1 Prozent. Vgl. Franz, Wolfgang; König,<br />
Heinz (1986). The Nature and Causes of Unemployment in the Federal Republic of Germany since the 1970s.<br />
Carstensen und Hansen (2000) erhalten für die Gesamtwirtschaft Westdeutschlands einen Koeffizienten von<br />
-0,7 Prozent. Vgl. Carstensen, Kai; Hansen, Gerd (2000). Cointegration and Common Trends on the West<br />
German Labour Market. Schneider et al. (2002) zeigen, dass der Rückgang der Arbeitsnachfrage bei weniger<br />
qualifizierter Arbeit deutlich stärker ausfällt. Vgl. Schneider, Hilmar; Zimmermann, Klaus F.; Bonin, Holger;<br />
Brenke, Karl; Haisken-DeNew, John; Kempe, Wolfram (2002). Beschäftigungspotenziale einer dualen<br />
Förderstrategie im Niedriglohnbereich.<br />
84