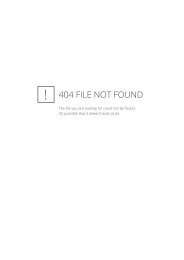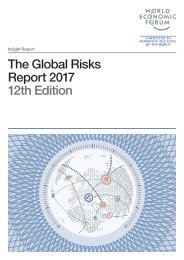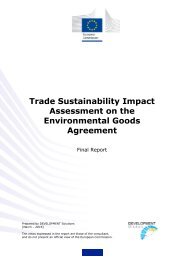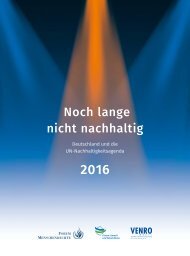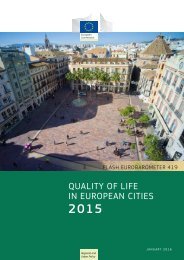Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2327<br />
2328<br />
2329<br />
2330<br />
2331<br />
2332<br />
2333<br />
2334<br />
2335<br />
2336<br />
2337<br />
2338<br />
2339<br />
2340<br />
2341<br />
2342<br />
2343<br />
2344<br />
2345<br />
2346<br />
2347<br />
2348<br />
2349<br />
2350<br />
2351<br />
2352<br />
2353<br />
2354<br />
2355<br />
2356<br />
2357<br />
2358<br />
2359<br />
2360<br />
2361<br />
2362<br />
2363<br />
2364<br />
2365<br />
2366<br />
2367<br />
2368<br />
2369<br />
2370<br />
2371<br />
2372<br />
2373<br />
2374<br />
2375<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
diese zunächst sehr optimistisch gesehen. Es stellte sich aber schon nach wenigen Jahren heraus, dass es hier um<br />
eine enorme wirtschafts-, fiskal-, staats- und gesellschaftspolitische Aufgabe ging, die noch weit über das<br />
hinausreichte, was die Zeit zwischen 1973 und 1989 zu bieten hatte. Insofern beschritt Deutschland ab 1990<br />
zwangsläufig einen europäischen Sonderweg, der über fast zwei Jahrzehnte lang auch die deutsche<br />
Wachstumsbilanz maßgeblich belastete.<br />
In stilisierter Form lässt sich die deutsche Einheit in ihren (belastenden) Wirkungen auf das<br />
gesamtwirtschaftliche Wachstum in fünf Punkten zusammenfassen: 39<br />
1. Der Aufbau Ost war eine massive fiskalische Belastung für den Staat. Währungsunion, Privatisierung<br />
<strong>des</strong> Kapitalbestan<strong>des</strong>, Erneuerung der Infrastruktur sowie die sozialstaatliche Absicherung <strong>des</strong><br />
Prozesses kosteten eine Summe, die auf einen Betrag irgendwo zwischen 1,5 und 2 Billionen Euro zu<br />
beziffern ist. Sie wurde teils von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, teils von den Kapitalmärkten<br />
aufgebracht – zulasten anderer Verwendungen.<br />
2. Die Lenkung von staatlichen und privaten Investitionen in den Osten sorgte über Jahre für eine Art<br />
vorübergehende Rückkehr zu einem „quantitativen“ Wachstum. Denn es ging zunächst darum,<br />
16 Millionen Menschen in einem Territorium von einem Drittel der Fläche Deutschlands mit einem<br />
funktionierenden, modernen Kapitalstock auszustatten. „Qualitatives“ Wachstum trat zunächst zurück.<br />
3. Die neu geschaffenen Kapazitäten im Osten erwiesen sich, vor allem was den Neubau betrifft, als eher<br />
zu großzügig bemessen. Es kam <strong>des</strong>halb schon ab der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zu einer<br />
nachhaltigen Belastung der Märkte für Immobilien, lokale Dienstleistungen und das Handwerk, was das<br />
Wachstum der Wertschöpfung in der Binnenwirtschaft beschränkte.<br />
4. Das ostdeutsche verarbeitende Gewerbe wuchs zwar ab 1992 kontinuierlich, aber doch viel langsamer<br />
als zu Beginn <strong>des</strong> “Aufbaus Ost“ erhofft. Eine kräftige Dynamik, gekoppelt mit einer<br />
Beschäftigungszunahme, setzte erst Mitte <strong>des</strong> zweiten Jahrzehnts nach der deutschen<br />
Wiedervereinigung ein. Es fehlte also lange Zeit ein hinreichend starkes industrielles Wachstum, das<br />
die Schwäche <strong>des</strong> Binnensektors hätte kompensieren können.<br />
5. Die hohe, zeitweise extrem hohe Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern sorgte im Osten für eine<br />
Aushöhlung <strong>des</strong> Flächentarifvertrags und in Deutschland insgesamt für überaus moderate<br />
Lohnabschlüsse. Tatsächlich blieben die Lohnstückkosten ab den späten 1990er Jahren fast eine Dekade<br />
lang annähernd konstant, was kurz- und mittelfristig die Binnennachfrage dämpfte, aber langfristig die<br />
Wettbewerbsfähigkeit verbesserte.<br />
Aus diesen Gründen erlebte der Westen <strong>des</strong> vereinigten Deutschlands nach 1989 einen kurzen Boom, der vor<br />
allem durch die Bauwirtschaft bedingt war. Schon ab Mitte der 1990er Jahre überwogen allerdings die genannten<br />
strukturell belastenden Faktoren. Die Wachstumsbilanz der deutschen Wirtschaft fällt <strong>des</strong>halb in der Phase 1991<br />
bis 2005 außerordentlich mäßig aus, mit einem jahresdurchschnittlichen Wachstum <strong>des</strong> BIP von gerade mal<br />
1,7 Prozent und einer Zunahme der Arbeitsproduktivität von 1,9 Prozent. 40 Es ist das schwächste Wachstum<br />
eines EU-Lan<strong>des</strong> in dieser historischen Phase. Es schien tatsächlich so, als würde Deutschland – was den<br />
Wachstumstrend Europas betrifft – ein Stück weit abgehängt.<br />
Auch was andere Wirtschaftsindikatoren betrifft, schien sich Deutschland in der ersten Hälfte der letzten Dekade<br />
auf einem negativen europäischen Spitzenplatz einzurichten: Die Arbeitslosenquote erreichte einen historischen<br />
Höchststand, die Anzahl der Langzeitarbeitslosen mit geringen Chancen der Reintegration ebenso. Gerade in<br />
dieser Phase setzte allerdings eine Welle von politischen Reformen ein, die heute in Europa als beispielhaft<br />
gelten. Dies gilt allen voran für den Komplex der Hartz-IV-Gesetzgebung zur Integration von Arbeitslosen- und<br />
Sozialhilfe, eine endgültige (und relative liberale) Regelung befristeter Beschäftigungsverhältnisse, ein neuer<br />
gesetzlicher Rahmen für die Zeitarbeit sowie schließlich die Einführung der Rente mit 67. Als Ganzes betrachtet,<br />
liefern diese Reformen die umfassendste Anpassung der sozialen Marktwirtschaft an neue Bedingungen, die es<br />
seit Bestehen der sozialen Marktwirtschaft gegeben hat. Zusammen mit der Flexibilisierung der<br />
Tarifvertragssysteme, die sich aus der deutschen Einheit ergab, schüttelte damit das spezifisch deutsche System<br />
<strong>des</strong> Kapitalismus zu einem großen Teil jene Nachteile ab, die ihm gerade von der Wirtschaftswissenschaft<br />
nachgesagt wurden.<br />
39<br />
Ausführlich dazu Paqué, Karl-Heinz (2009). Die Bilanz.<br />
40<br />
Eigene Berechnungen nach Statistisches Bun<strong>des</strong>amt (2013). Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen.<br />
59