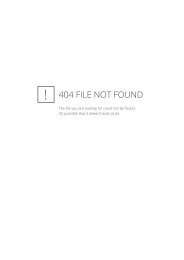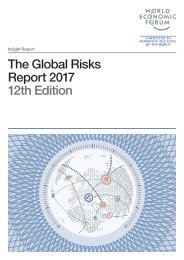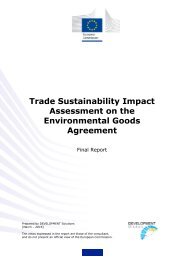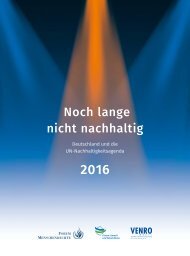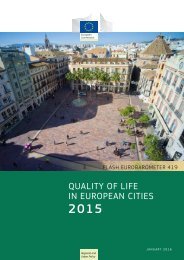Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
6639<br />
6640<br />
6641<br />
6642<br />
6643<br />
6644<br />
6645<br />
6646<br />
6647<br />
6648<br />
6649<br />
6650<br />
6651<br />
6652<br />
6653<br />
6654<br />
6655<br />
6656<br />
6657<br />
6658<br />
6659<br />
6660<br />
6661<br />
6662<br />
6663<br />
6664<br />
6665<br />
6666<br />
6667<br />
6668<br />
6669<br />
6670<br />
6671<br />
6672<br />
6673<br />
6674<br />
6675<br />
6676<br />
6677<br />
6678<br />
6679<br />
6680<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Die ökonomische Theorie besagt: Globalisierung und technischer Fortschritt bringen häufig hoch<br />
qualifizierten Arbeiterinnen und Arbeitern größere Vorteile als niedrig qualifizierten. Gründe hierfür<br />
sind: (1) Der rasche Anstieg der Integration von Handel und Finanzmärkten erzeugt – zugunsten hoch<br />
qualifizierter Arbeitskräfte – eine relative Verschiebung in der Nachfrage nach Arbeitskräften. (2) Der<br />
technologische Fortschritt verlagert Fertigungstechnologien zugunsten von qualifizierten<br />
Arbeitskräften, und zwar in Industrie und Dienstleistungen.<br />
Die Analysen der OECD ergaben (für die OECD-Länder insgesamt): Weder steigende<br />
Handelsintegration noch finanzielle Offenheit hatten einen signifikanten Einfluss auf die Beschäftigung<br />
oder die Lohnungleichheit. Stärkere Kapitalströme und der technologische Wandel dagegen schon.<br />
Zwischen 1980 und 2008 kam es in den meisten OECD-Ländern zu Gesetzesänderungen, die die Ziele<br />
verfolgten, den Wettbewerb in den Güter- und Dienstleistungsmärkten zu stärken und die Arbeitsmärkte<br />
anpassungsfähiger zu machen. Maßnahmen hierfür waren: Lockerung der wettbewerbswidrigen<br />
Produktmarktvorschriften sowie <strong>des</strong> Kündigungsschutzrechts für Arbeiter mit befristeten Verträgen.<br />
Min<strong>des</strong>tlöhne sind in diesem Zeitraum in Relation zum Medianlohn ebenfalls gesunken. In den<br />
Tarifverhandlungen konnten zunehmend keine verteilungsneutralen Abschlüsse mehr erzielt werden.<br />
Aufgrund <strong>des</strong> zeitweise gesunkenen Organisationsgra<strong>des</strong> der Gewerkschaften (inzwischen zeichnet sich<br />
ein Ende dieses Trends ab) weiteten sich tariffreie Zonen aus. Hinzu kamen gesetzliche Veränderungen<br />
(Leiharbeit, Regelungen zu Mini- und Midijobs et cetera), sodass die gesamten Bruttolöhne noch weiter<br />
hinter einem verteilungsneutralen Ergebnis zurückblieben. Zudem wurden Lohnersatzleistungen<br />
gekürzt, Steuern auf Vermögen und Einkommen reduziert, wobei die Entlastungen mit der Vermögensund<br />
Einkommenshöhe deutlich zunahmen. Diese Veränderungen in Politik und Institutionen hatten<br />
einen erheblichen Einfluss auf die Verteilungssituation.<br />
Ergebnisse <strong>des</strong> Prozesses: (1) Positiver Einfluss auf das Beschäftigungsniveau, was allerdings stark<br />
zulasten der Qualität der Beschäftigung gegangen ist, was (2) zu gestiegenen Lohnunterschieden<br />
(„Lohnspreizung“) geführt hat. 457<br />
Die Zunahme der Teilzeitarbeit hat zur gestiegenen Lohnungleichheit beigetragen. Die Teilzeitquote<br />
lag 2011 bei 34,5 Prozent aller abhängig Beschäftigten gegenüber 15,7 Prozent im Jahre 1991.<br />
Insgesamt liegen die jährlich geleisteten Arbeitsstunden (Arbeitsvolumen) trotz <strong>des</strong> Anstiegs in den<br />
beiden Jahren vor und nach dem Kriseneinbruch 2008 immer noch unter dem Niveau von 1991. 458<br />
Frauen befinden sich nach wie vor in einer speziellen Situation: Zwar steigt die Beschäftigungsquote<br />
von Frauen an, aber das Arbeitsvolumen der erwerbstätigen Frauen hat sich nicht verändert: Immer<br />
mehr Frauen arbeiten in Teilzeit. Zudem erhalten sie häufig bei gleichem Bildungsniveau und für<br />
dieselbe Arbeit einen geringeren Lohn als Männer.<br />
Der Trend zu kleineren Haushalten steigert Lohn- und Einkommensungleichheit. Auch die<br />
„Paarungssiebung“ hat zur steigenden Ungleichheit beigetragen (ein Arzt heiratet eine Ärztin und<br />
nicht (mehr) die Krankenschwester).<br />
Die Ungleichheit der Kapitaleinkommen ist in den letzten Jahren durchschnittlich stärker gestiegen als<br />
die bei den Lohneinkommen. Allerdings stellt das Kapitaleinkommen lediglich 7 Prozent <strong>des</strong><br />
Gesamteinkommens eines Haushaltes. Der Einfluss <strong>des</strong> Kapitaleinkommens auf die<br />
Haushaltseinkommensungleichheit war <strong>des</strong>halb im Vergleich zum Einfluss von Lohneinkommen gering<br />
(Deutschland stellt hier eine Ausnahme dar, hier war der Einfluss bedeutend). Kapitaleinkommen<br />
wurde gerade für wohlhabende Haushalte eine größere Quelle von Haushaltseinkommen.<br />
455<br />
Für den Bereich der Vermögensungleichheit gibt es keine vergleichenden Studien.<br />
456<br />
Siehe Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2008). Growing Unequal?;<br />
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2011). Divided We Stand; Organisation for<br />
Economic Co-operation and Development (OECD) (2011). Country Note: Germany; Organisation for Economic<br />
Co-operation and Development (OECD) (2008). Mehr Wohlstand durch Wachstum?<br />
457<br />
In den meisten Fällen ist der kombinierte Einfluss dieser Faktoren auf die allgemeine<br />
Einkommensungleichheit und Haushaltseinkommen weniger klar.<br />
458<br />
Siehe ausführlich Kapitel 3.5.2 dieses Sondervotums.<br />
192