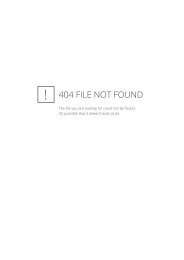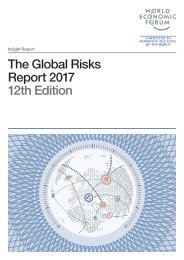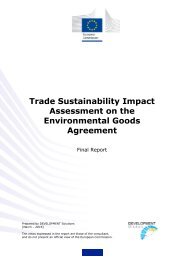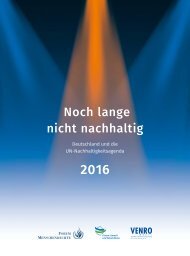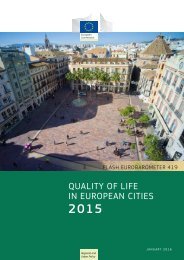Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Deutscher Bundestag Entwurf des Gesamtberichts
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
3651<br />
3652<br />
3653<br />
3654<br />
3655<br />
3656<br />
3657<br />
3658<br />
3659<br />
3660<br />
3661<br />
3662<br />
3663<br />
3664<br />
3665<br />
3666<br />
3667<br />
3668<br />
3669<br />
3670<br />
3671<br />
3672<br />
3673<br />
3674<br />
3675<br />
3676<br />
3677<br />
3678<br />
3679<br />
3680<br />
3681<br />
3682<br />
3683<br />
3684<br />
3685<br />
3686<br />
3687<br />
3688<br />
3689<br />
3690<br />
3691<br />
3692<br />
3693<br />
3694<br />
3695<br />
3696<br />
3697<br />
3698<br />
3699<br />
3700<br />
Enquete Gesamtbericht Stand 8.4.2013: Teil B: Projektgruppe 1<br />
Industrien immer mehr und größere Segmente der Produktion, die aus der Sicht <strong>des</strong> Industrielan<strong>des</strong> einfache<br />
Arbeit intensiv nutzen und sich <strong>des</strong>halb für eine Verlagerung anbieten. Die früher übliche Vorstellung, dass es<br />
irgendwann praktisch keine arbeitsintensiven Produktionen mehr gibt, die man verlagern könnte, wird<br />
zunehmend hinterfragt. Zum anderen steht eine völlig neue Dimension der Integration bevor – mit sehr großen<br />
Entwicklungsländern (Brasilien, China, Indien, Indonesien und andere), die gerade erst mit voller Dynamik<br />
ansetzen, in die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung hineinzuwachsen. Es ist sehr fraglich, ob dann<br />
ökonometrische Erkenntnisse zur Globalisierung, die vor allem aus den 1980er und 1990er Jahren stammen,<br />
noch sehr aussagekräftig für die Zukunft sind.<br />
Tatsächlich ist die Unsicherheit über die künftige Entwicklung groß, und zwar nicht nur mit Blick auf die<br />
theoretische Erklärung <strong>des</strong> „skill bias“, sondern auch, was überhaupt <strong>des</strong>sen Fortdauer betrifft. So ist im Bereich<br />
<strong>des</strong> internationalen Handels ohne Weiteres vorstellbar, dass der Konkurrenzdruck der Entwicklungs- und<br />
Schwellenländer sich ausweitet und zunehmend auch bestimmte Formen der qualifizierten Arbeit in<br />
Industrieländern betrifft. Dies gilt vor allem für jene Arbeitsbereiche, die inhaltlich relativ leicht digitalisierbar<br />
sind und damit offshore von (niedrig bezahlten, aber gut qualifizierten) Beschäftigten bearbeitet werden können.<br />
Erste Beispiele dafür hat Indien mit den Softwarezentren in Bangalore geliefert. Auch bei der technischen<br />
Entwicklung bleiben viele Fragezeichen, was die künftige Wirkung auf den Arbeitsmarkt betrifft. Auch dort sind<br />
zum Beispiel die Folgen der Digitalisierung keineswegs leicht vorhersehbar. So mögen neue Entwicklungen in<br />
der Informations- und Kommunikationstechnik für bestimmte berufliche Qualifikationen eine weit größere<br />
Bedrohung darstellen als für eine körperliche Tätigkeit im Dienstleistungsbereich, die an formaler Ausbildung<br />
weit weniger Anspruchsvolles erfordert. Man könnte sich etwa vorstellen, dass neue Techniken der<br />
Dokumentation genau jene Berufsgruppen besonders hart treffen, die qualifizierte, aber durch Routinevorgänge<br />
geprägte Arbeit leisten – von der Archivarin oder vom Archivar bis zur Buchhalterin oder zum Buchhalter.<br />
Dagegen könnte sich einfaches Hilfspersonal etwa in der Altenpflege als zunehmend knapp und durch Technik<br />
nicht ersetzbar erweisen. Es wäre <strong>des</strong>halb überaus leichtfertig, die Erfahrungen vergangener Jahrzehnte einfach<br />
fortzuschreiben.<br />
Hinzu kommt eine weitere Frage, die schwierig zu beantworten ist: Wie wird sich das Arbeitsangebot<br />
entwickeln? Und vor allem: Wird es in der Zukunft möglich sein, durch politische und wirtschaftliche<br />
Weichenstellungen (zum Beispiel eine „Bildungsoffensive“) die Qualifikationsniveaus- und Profile der<br />
Arbeitskräfte in den OECD-Ländern besser den Erfordernissen anzupassen, als dies bisher offenbar der Fall war?<br />
Zwei zentrale Argumente sprechen dafür, dass es dafür reale Chancen gibt: Zum einen hat das politische<br />
Bewusstsein für die enorme soziale Bedeutung der Fragestellung in den letzten Jahren stark zugenommen, nicht<br />
zuletzt auch wegen der bitteren Erfahrungen aus der Vergangenheit. Zum anderen könnte es in den OECD-<br />
Ländern – und vor allem in den wirtschaftlich stabilen Nationen mit hochinnovativer Industrie (so wie<br />
Deutschland) – aufgrund der demografischen Entwicklung zu einer derart dramatischen Knappheit an<br />
qualifizierten Arbeitskräften kommen, dass der wirtschaftliche Anreiz für Unternehmen zunimmt, auch<br />
minderqualifizierte Arbeitskräfte durch eine betriebliche Ausbildung auf technisch anspruchsvolle Tätigkeiten<br />
und verantwortungsvolle Aufgaben vorzubereiten (und zwar auch ohne staatliche Subventionierung!). 165 Genau<br />
diesen Anreiz hat es in den Zeiten der breiten Massenarbeitslosigkeit seit Mitte der 1970er in Deutschland und<br />
anderen Ländern nicht gegeben. Erste Ansätze zu einer Veränderung <strong>des</strong>sen, was man „Ausbildungsklima“<br />
nennen könnte, sind bereits heute zu beobachten.<br />
4 Finanz- und gesellschaftspolitische Herausforderungen<br />
4.1 Demografischer Wandel, Bildung und Innovationen<br />
Wirtschaftswachstum in hoch entwickelten Industrienationen wie Deutschland ist, wie in der Einleitung <strong>des</strong><br />
Berichts ausgeführt, vor allem das Ergebnis von Innovationskraft. Eine Wirtschaft, in der immer neues<br />
marktfähiges Wissen entsteht, kann durch neue Produkte und Prozesse immer neue „Pionierrenten“<br />
erwirtschaften und in Wertschöpfung und Einkommen umsetzen. Die alten Pionierrenten schmelzen zwar dahin,<br />
sobald Nachahmer und Nachzügler aufholen, aber es kommen eben neue hinzu, die den Vorsprung sichern. Dies<br />
kann allerdings nur gelingen, wenn die Volkswirtschaft unverändert leistungsfähig und innovationskräftig bleibt.<br />
Diese Leistungsfähigkeit hängt letztlich von den Menschen ab. Zahl, Fleiß, Können, Motivation und Originalität<br />
der Arbeitskräfte entscheiden darüber, wie viel an Ideen und Innovationen eine Gesellschaft zustande bringt und<br />
165<br />
Dazu im Einzelnen Paqué, Karl-Heinz (2012). Vollbeschäftigt: Kapitel 3.<br />
99