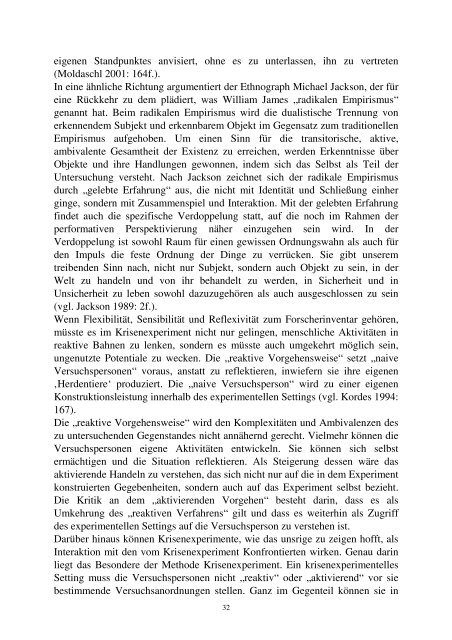Für meine Eltern Lena & Rolf - Monkeydick-Productions
Für meine Eltern Lena & Rolf - Monkeydick-Productions
Für meine Eltern Lena & Rolf - Monkeydick-Productions
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
eigenen Standpunktes anvisiert, ohne es zu unterlassen, ihn zu vertreten<br />
(Moldaschl 2001: 164f.).<br />
In eine ähnliche Richtung argumentiert der Ethnograph Michael Jackson, der für<br />
eine Rückkehr zu dem plädiert, was William James „radikalen Empirismus“<br />
genannt hat. Beim radikalen Empirismus wird die dualistische Trennung von<br />
erkennendem Subjekt und erkennbarem Objekt im Gegensatz zum traditionellen<br />
Empirismus aufgehoben. Um einen Sinn für die transitorische, aktive,<br />
ambivalente Gesamtheit der Existenz zu erreichen, werden Erkenntnisse über<br />
Objekte und ihre Handlungen gewonnen, indem sich das Selbst als Teil der<br />
Untersuchung versteht. Nach Jackson zeichnet sich der radikale Empirismus<br />
durch „gelebte Erfahrung“ aus, die nicht mit Identität und Schließung einher<br />
ginge, sondern mit Zusammenspiel und Interaktion. Mit der gelebten Erfahrung<br />
findet auch die spezifische Verdoppelung statt, auf die noch im Rahmen der<br />
performativen Perspektivierung näher einzugehen sein wird. In der<br />
Verdoppelung ist sowohl Raum für einen gewissen Ordnungswahn als auch für<br />
den Impuls die feste Ordnung der Dinge zu verrücken. Sie gibt unserem<br />
treibenden Sinn nach, nicht nur Subjekt, sondern auch Objekt zu sein, in der<br />
Welt zu handeln und von ihr behandelt zu werden, in Sicherheit und in<br />
Unsicherheit zu leben sowohl dazuzugehören als auch ausgeschlossen zu sein<br />
(vgl. Jackson 1989: 2f.).<br />
Wenn Flexibilität, Sensibilität und Reflexivität zum Forscherinventar gehören,<br />
müsste es im Krisenexperiment nicht nur gelingen, menschliche Aktivitäten in<br />
reaktive Bahnen zu lenken, sondern es müsste auch umgekehrt möglich sein,<br />
ungenutzte Potentiale zu wecken. Die „reaktive Vorgehensweise“ setzt „naive<br />
Versuchspersonen“ voraus, anstatt zu reflektieren, inwiefern sie ihre eigenen<br />
‚Herdentiere‘ produziert. Die „naive Versuchsperson“ wird zu einer eigenen<br />
Konstruktionsleistung innerhalb des experimentellen Settings (vgl. Kordes 1994:<br />
167).<br />
Die „reaktive Vorgehensweise“ wird den Komplexitäten und Ambivalenzen des<br />
zu untersuchenden Gegenstandes nicht annähernd gerecht. Vielmehr können die<br />
Versuchspersonen eigene Aktivitäten entwickeln. Sie können sich selbst<br />
ermächtigen und die Situation reflektieren. Als Steigerung dessen wäre das<br />
aktivierende Handeln zu verstehen, das sich nicht nur auf die in dem Experiment<br />
konstruierten Gegebenheiten, sondern auch auf das Experiment selbst bezieht.<br />
Die Kritik an dem „aktivierenden Vorgehen“ besteht darin, dass es als<br />
Umkehrung des „reaktiven Verfahrens“ gilt und dass es weiterhin als Zugriff<br />
des experimentellen Settings auf die Versuchsperson zu verstehen ist.<br />
Darüber hinaus können Krisenexperimente, wie das unsrige zu zeigen hofft, als<br />
Interaktion mit den vom Krisenexperiment Konfrontierten wirken. Genau darin<br />
liegt das Besondere der Methode Krisenexperiment. Ein krisenexperimentelles<br />
Setting muss die Versuchspersonen nicht „reaktiv“ oder „aktivierend“ vor sie<br />
bestimmende Versuchsanordnungen stellen. Ganz im Gegenteil können sie in<br />
32