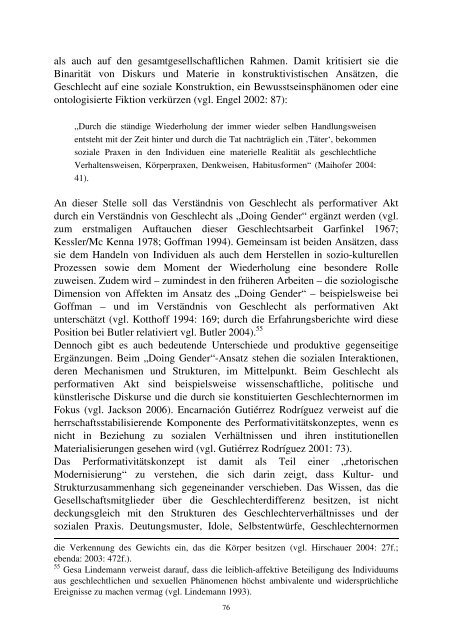Für meine Eltern Lena & Rolf - Monkeydick-Productions
Für meine Eltern Lena & Rolf - Monkeydick-Productions
Für meine Eltern Lena & Rolf - Monkeydick-Productions
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
als auch auf den gesamtgesellschaftlichen Rahmen. Damit kritisiert sie die<br />
Binarität von Diskurs und Materie in konstruktivistischen Ansätzen, die<br />
Geschlecht auf eine soziale Konstruktion, ein Bewusstseinsphänomen oder eine<br />
ontologisierte Fiktion verkürzen (vgl. Engel 2002: 87):<br />
„Durch die ständige Wiederholung der immer wieder selben Handlungsweisen<br />
entsteht mit der Zeit hinter und durch die Tat nachträglich ein ‚Täter‘, bekommen<br />
soziale Praxen in den Individuen eine materielle Realität als geschlechtliche<br />
Verhaltensweisen, Körperpraxen, Denkweisen, Habitusformen“ (Maihofer 2004:<br />
41).<br />
An dieser Stelle soll das Verständnis von Geschlecht als performativer Akt<br />
durch ein Verständnis von Geschlecht als „Doing Gender“ ergänzt werden (vgl.<br />
zum erstmaligen Auftauchen dieser Geschlechtsarbeit Garfinkel 1967;<br />
Kessler/Mc Kenna 1978; Goffman 1994). Gemeinsam ist beiden Ansätzen, dass<br />
sie dem Handeln von Individuen als auch dem Herstellen in sozio-kulturellen<br />
Prozessen sowie dem Moment der Wiederholung eine besondere Rolle<br />
zuweisen. Zudem wird – zumindest in den früheren Arbeiten – die soziologische<br />
Dimension von Affekten im Ansatz des „Doing Gender“ – beispielsweise bei<br />
Goffman – und im Verständnis von Geschlecht als performativen Akt<br />
unterschätzt (vgl. Kotthoff 1994: 169; durch die Erfahrungsberichte wird diese<br />
Position bei Butler relativiert vgl. Butler 2004). 55<br />
Dennoch gibt es auch bedeutende Unterschiede und produktive gegenseitige<br />
Ergänzungen. Beim „Doing Gender“-Ansatz stehen die sozialen Interaktionen,<br />
deren Mechanismen und Strukturen, im Mittelpunkt. Beim Geschlecht als<br />
performativen Akt sind beispielsweise wissenschaftliche, politische und<br />
künstlerische Diskurse und die durch sie konstituierten Geschlechternormen im<br />
Fokus (vgl. Jackson 2006). Encarnación Gutiérrez Rodríguez verweist auf die<br />
herrschaftsstabilisierende Komponente des Performativitätskonzeptes, wenn es<br />
nicht in Beziehung zu sozialen Verhältnissen und ihren institutionellen<br />
Materialisierungen gesehen wird (vgl. Gutiérrez Rodríguez 2001: 73).<br />
Das Performativitätskonzept ist damit als Teil einer „rhetorischen<br />
Modernisierung“ zu verstehen, die sich darin zeigt, dass Kultur- und<br />
Strukturzusammenhang sich gegeneinander verschieben. Das Wissen, das die<br />
Gesellschaftsmitglieder über die Geschlechterdifferenz besitzen, ist nicht<br />
deckungsgleich mit den Strukturen des Geschlechterverhältnisses und der<br />
sozialen Praxis. Deutungsmuster, Idole, Selbstentwürfe, Geschlechternormen<br />
die Verkennung des Gewichts ein, das die Körper besitzen (vgl. Hirschauer 2004: 27f.;<br />
ebenda: 2003: 472f.).<br />
55 Gesa Lindemann verweist darauf, dass die leiblich-affektive Beteiligung des Individuums<br />
aus geschlechtlichen und sexuellen Phänomenen höchst ambivalente und widersprüchliche<br />
Ereignisse zu machen vermag (vgl. Lindemann 1993).<br />
76