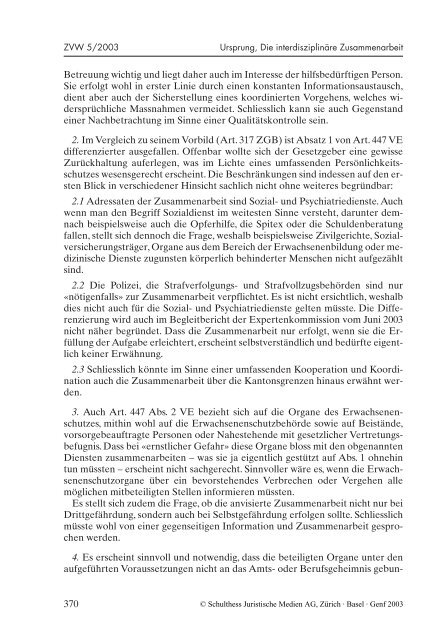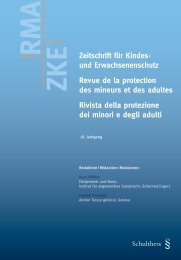RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
RDT - Numéro spécial concernant la révision - VBK-CAT
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ZVW 5/2003<br />
Ursprung, Die interdisziplinäre Zusammenarbeit<br />
Betreuung wichtig und liegt daher auch im Interesse der hilfsbedürftigen Person.<br />
Sie erfolgt wohl in erster Linie durch einen konstanten Informationsaustausch,<br />
dient aber auch der Sicherstellung eines koordinierten Vorgehens, welches widersprüchliche<br />
Massnahmen vermeidet. Schliesslich kann sie auch Gegenstand<br />
einer Nachbetrachtung im Sinne einer Qualitätskontrolle sein.<br />
2. Im Vergleich zu seinem Vorbild (Art. 317 ZGB) ist Absatz 1 von Art. 447 VE<br />
differenzierter ausgefallen. Offenbar wollte sich der Gesetzgeber eine gewisse<br />
Zurückhaltung auferlegen, was im Lichte eines umfassenden Persönlichkeitsschutzes<br />
wesensgerecht erscheint. Die Beschränkungen sind indessen auf den ersten<br />
Blick in verschiedener Hinsicht sachlich nicht ohne weiteres begründbar:<br />
2.1 Adressaten der Zusammenarbeit sind Sozial- und Psychiatriedienste. Auch<br />
wenn man den Begriff Sozialdienst im weitesten Sinne versteht, darunter demnach<br />
beispielsweise auch die Opferhilfe, die Spitex oder die Schuldenberatung<br />
fallen, stellt sich dennoch die Frage, weshalb beispielsweise Zivilgerichte, Sozialversicherungsträger,<br />
Organe aus dem Bereich der Erwachsenenbildung oder medizinische<br />
Dienste zugunsten körperlich behinderter Menschen nicht aufgezählt<br />
sind.<br />
2.2 Die Polizei, die Strafverfolgungs- und Strafvollzugsbehörden sind nur<br />
«nötigenfalls» zur Zusammenarbeit verpflichtet. Es ist nicht ersichtlich, weshalb<br />
dies nicht auch für die Sozial- und Psychiatriedienste gelten müsste. Die Differenzierung<br />
wird auch im Begleitbericht der Expertenkommission vom Juni 2003<br />
nicht näher begründet. Dass die Zusammenarbeit nur erfolgt, wenn sie die Erfüllung<br />
der Aufgabe erleichtert, erscheint selbstverständlich und bedürfte eigentlich<br />
keiner Erwähnung.<br />
2.3 Schliesslich könnte im Sinne einer umfassenden Kooperation und Koordination<br />
auch die Zusammenarbeit über die Kantonsgrenzen hinaus erwähnt werden.<br />
3. Auch Art. 447 Abs. 2 VE bezieht sich auf die Organe des Erwachsenenschutzes,<br />
mithin wohl auf die Erwachsenenschutzbehörde sowie auf Beistände,<br />
vorsorgebeauftragte Personen oder Nahestehende mit gesetzlicher Vertretungsbefugnis.<br />
Dass bei «ernstlicher Gefahr» diese Organe bloss mit den obgenannten<br />
Diensten zusammenarbeiten – was sie ja eigentlich gestützt auf Abs. 1 ohnehin<br />
tun müssten – erscheint nicht sachgerecht. Sinnvoller wäre es, wenn die Erwachsenenschutzorgane<br />
über ein bevorstehendes Verbrechen oder Vergehen alle<br />
möglichen mitbeteiligten Stellen informieren müssten.<br />
Es stellt sich zudem die Frage, ob die anvisierte Zusammenarbeit nicht nur bei<br />
Drittgefährdung, sondern auch bei Selbstgefährdung erfolgen sollte. Schliesslich<br />
müsste wohl von einer gegenseitigen Information und Zusammenarbeit gesprochen<br />
werden.<br />
4. Es erscheint sinnvoll und notwendig, dass die beteiligten Organe unter den<br />
aufgeführten Voraussetzungen nicht an das Amts- oder Berufsgeheimnis gebun-<br />
370 © Schulthess Juristische Medien AG, Zürich · Basel · Genf 2003