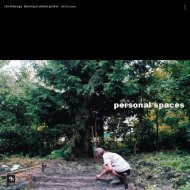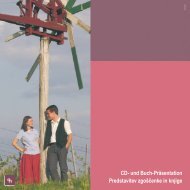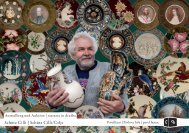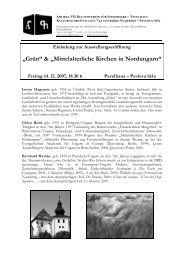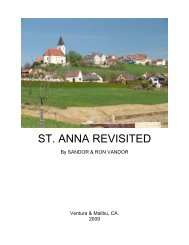winter/zima 2006/2007 Es ist immer das Gleiche ... - Pavlova hiša
winter/zima 2006/2007 Es ist immer das Gleiche ... - Pavlova hiša
winter/zima 2006/2007 Es ist immer das Gleiche ... - Pavlova hiša
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Eine Begegnung – oder „Wer <strong>immer</strong> ein Menschenleben rettet ...“<br />
auch anderen jüdischen Zwangsarbeitern und<br />
setzte sich damit selbst einer großen Gefahr<br />
aus. Die Bewachungsmannschaft (vor allem<br />
SS-Soldaten) der Juden oder die im Ort befindlichen<br />
deutschen Gendarmen hätten ihre<br />
verbotene Hilfele<strong>ist</strong>ung für einen Juden jederzeit<br />
entdecken können. 15<br />
Alan Brown. Der erwähnte Jude hieß Alan<br />
Braun und war Anfang des Jahres 1945 noch<br />
keine 17 Jahre alt. Er wurde am 20. März 1928<br />
als Sohn von Erma und Sandor Braun im nordostungarischen<br />
Miskolc geboren. 16 Der Vater<br />
war Getreidehändler, die Mutter Lehrerin an<br />
einer jüdischen Schule. Alan Braun wuchs in<br />
einem orthodoxen Haus auf.<br />
Sandor Braun wurde bereits 1943 zur Zwangsarbeit<br />
eingezogen (den Juden in Ungarn war<br />
zwar der Militärdienst mit der Waffe untersagt,<br />
sie mussten aber ihm Rahmen der Armee<br />
Zwangsarbeit le<strong>ist</strong>en). Im März 1944 wurde<br />
Ungarn von den Deutschen besetzt, und damit<br />
begann für die ungarischen Juden der Leidensweg,<br />
der für einen Großteil von ihnen in<br />
Auschwitz endete. Alan Braun war damals<br />
erst 16 Jahre alt, gab sich aber als 18-Jähriger<br />
aus – dies rettete sein Leben. Er wurde zur<br />
Zwangsarbeit in eine Kohlenmine bei Košice<br />
(heute Südostslowakei) gebracht, wo er seinen<br />
Vater wieder traf. Beide kamen dann später in<br />
eine Fabrik in Budapest, ehe sie im Dezember<br />
1944 in ein Lager in Sopron deportiert wurden.<br />
Von Sopron gelangten beide dann zuerst in<br />
ein Lager nach Feldbach und dann weiter nach<br />
15 Szabolcs Szita, Zwangsarbeit, Todesmärsche, Überleben, S. 119<br />
erwähnt die „opferreiche Hilfe der Ortsapothekerin“. Gegen sie<br />
sei auch die SS eingeschritten, sie sei zweimal verhört worden.<br />
Könnte damit Rosa Freißmuth gemeint sein (die auch im „Lexikon<br />
der Gerechten unter den Völkern“ fälschlicherweise als<br />
Apothekerin bezeichnet wird)?<br />
16 http://holocaustcenter.org/OralH<strong>ist</strong>ory/Synopsis.php?file=190<br />
(1.3.<strong>2006</strong>); http://www.holocaustcenterbn.org/survivors/alan_<br />
brown/ (1.3.<strong>2006</strong>).<br />
10<br />
Neuhaus am Klausenbach, wo sie bald mit der<br />
Brutalität der SS-Wachen konfrontiert wurden.<br />
Sie mussten mit den anderen jüdischen<br />
Zwangsarbeitern Panzergräben ausheben. Auf<br />
Grund der schlechten Verpflegung und der unbeschreiblichen<br />
hygienischen Zustände im Lager<br />
erkrankten bald auch Sandor Braun und<br />
sein Sohn Alan an Flecktyphus. Sie hüteten sich<br />
aber davor, ins Lazarett gebracht zu werden, da<br />
von dort niemand zurückkehrte. So wandte<br />
sich Alan Brown eines Nachts an Rosa Freißmuth,<br />
die Besitzerin des Kaufhauses, um Hilfe,<br />
was schließlich ihr Überleben ermöglichte.<br />
Ende März 1945 wurden die noch marschfähigen<br />
ungarischen Juden von ihren Bewachern<br />
in einem Gewaltmarsch nach Mauthausen getrieben.<br />
Alan und Sandor Braun wurden aber<br />
mit einigen anderen Kranken auf Lastwagen<br />
verladen, vielleicht um sie zu exekutieren.<br />
Nach einigen Kilometern mussten sie wieder<br />
vom Lastwagen herunter und wurden von ihren<br />
Bewachern überraschend zurückgelassen.<br />
Diese flohen offenbar vor den heranrückenden<br />
sowjetischen Truppen. Am nächsten Tag<br />
wurden die kranken ungarischen Juden von<br />
sowjetischen Soldaten befreit. Der Vater Sandor<br />
Braun verstarb aber in der folgenden Nacht<br />
und musste von seinem Sohn Alan mit Hilfe<br />
anderer Überlebender begraben werden. Braun<br />
und andere Kranke waren zu diesem Zeitpunkt<br />
in der damals leer stehenden Schule von Kalch<br />
untergebracht. Diese Schule diente als Krankenstation<br />
für typhuskranke Stellungsbauarbeiter,<br />
wie ein Bericht der damals noch selbstständigen<br />
Gemeinde Kalch aus dem Jahre 1957<br />
festhielt. 17 Jedenfalls wurden Sandor Braun<br />
17 BLA, A/VIII/11/ – Ereignisse 1945–1956, Berichte der Gemeinden,<br />
Kalch; Udo Fellner, Bittere Heimatgeschichte. Das<br />
Schicksal der jüdischen Zwangsarbeiter in Krottendorf und<br />
Kalch; in: Gerhard Baumgartner – Eva Müllner – Rainer Münz<br />
(Hg.), Identität und Lebenswelt. Ethnische, religiöse und kulturelle<br />
Vielfalt im Burgenland. Eisenstadt 1989, S. 129.