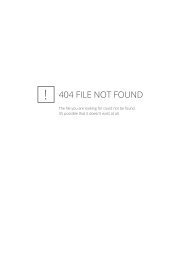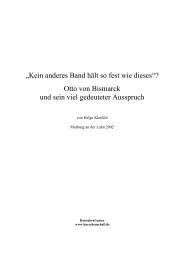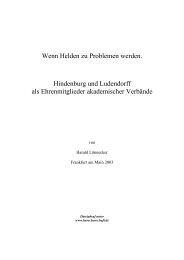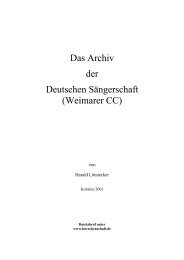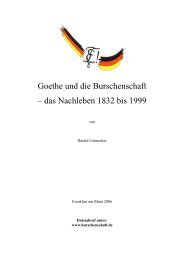PDF-Dokument - Burschenschaftsgeschichte
PDF-Dokument - Burschenschaftsgeschichte
PDF-Dokument - Burschenschaftsgeschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
II. Teil Konfliktfeld: Staat – Gesellschaft – Burschenschaft in München von 1826 bis 1833 132<br />
von Volkssouveränität und monarchischen Souveränität getreu der Vertragstheorie<br />
einforderte. 371 Dabei startete Ludwig in seiner Kronprinzenzeit durchaus als Verfechter<br />
einer Interessensbalance zwischen „Volk“, in diesem Fall mit Übergewicht des<br />
Besitzbürgertums als dessen legislativem Machtfaktor, und der monarchischen<br />
Exekutivgewalt. Von daher ist seine Kritik an der Verfassung von 1818, die ihm in<br />
wesentlichen Teilen (unter anderem ausschließliche Gesetzesinitiative durch die<br />
Regierung ohne Beteiligung der Kammern) nicht weit genug ging und an den Karlsbader<br />
Beschlüssen, deren Eingriffsrechte in die einzelstaatlichen Belange er als<br />
verfassungswidrig ablehnte, durchaus nachvollziehbar.<br />
Bezeichnenderweise wird Ludwig bei Antritt seiner Königswürde im Jahre 1825 von einer<br />
konstitutionellen Weiterentwicklung der Verfassung, die seine Machtvollkommenheit in<br />
Frage stellen würde, nichts wissen wollen, obschon er nach wie vor bestrebt ist, durch<br />
großzügige Gesten – von denen später die Rede sein wird – seinen liberalen Geist und<br />
seine königliche Huld und Gnade unter Beweis zu stellen. Bei Lichte besehen, werden<br />
alle diese Aktivitäten einen bezeichnenden Grundzug des königlichen Seelenhaushalts<br />
geschärft zum Vorschein bringen: Er will gefallen, und dies um einen hohen Preis, vor<br />
allem geriert er sich unter anderem liberaler als die vermeintliche liberale Partei selbst,<br />
und er zieht sich sofort hinter die Mauern der Ablehnung und des Schweigens zurück bei<br />
der geringsten Gefahr, instrumentalisiert zu werden. 372 Widersprüche, mitunter auch<br />
Überschneidungen, prägen generell Ludwigs Wertesystem; dieses läßt sich – ohne dies<br />
weiter vertiefen zu wollen – für sein Geschichtsbewußtsein ebenso wie für seine<br />
Kunstvorstellungen belegen. Gegensätze lösen in ihm keine Irritationen aus, er ist<br />
vielmehr Enthusiast und nicht Systematiker, fühlt in sich den Künstler, verläßt aber selten<br />
die Ebene des Kunstliebhabers, begeistert sich schnell und ermüdet ebenso rasch, er<br />
eignet sich viel an, kümmert sich um alles und verharrt doch oft im Halben.<br />
Rigoroses Staatskirchentum bei gleichzeitig tiefer persönlicher Religiosität, bayerisches<br />
Souveränitätsstreben und deutsches Nationalbewußtsein gelten ihm durchaus als<br />
miteinander vereinbare Grundsätze. Der Deutsche Bund ist ihm sympathisch, wenn er<br />
Anstalten macht, ihn aus einer innenpolitischen Klemme zu befreien, wird aber rigoros in<br />
seine Schranken gewiesen, wenn kein Handlungsbedarf besteht. 373<br />
Sein unkontrolliertes persönliches Regiment verstärkt auch die innenpolitische<br />
Konzeptionslosigkeit und Unsicherheit. Schneller Systemwechsel hat einen ebenso<br />
schnellen Ministerwechsel zur Folge. Zweckbündnisse mit gesellschaftlich<br />
371<br />
372<br />
373<br />
vgl. Glaser,Hubert: ZBLG 50,2 (1987) S. 147-149<br />
vgl. ebd. S. 146f<br />
vgl. Treml, Manfred: München 1994, S. 46f