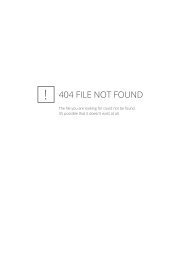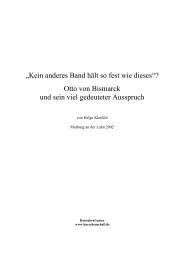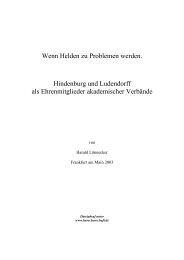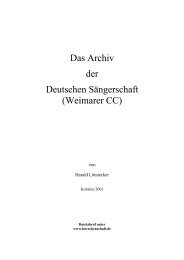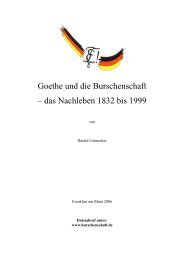PDF-Dokument - Burschenschaftsgeschichte
PDF-Dokument - Burschenschaftsgeschichte
PDF-Dokument - Burschenschaftsgeschichte
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
I. Teil Konfliktfeld: Staat – Gesellschaft – Landsmannschaften in Landshut von 1800 bis 1826 37<br />
heutigen Erscheinungsbild. Die großen Veränderungen vollzogen sich im 19. Jahrhundert<br />
eher an der Peripherie der Stadt, vor allem hervorgerufen durch den Eisenbahnbau. Zur<br />
Zeit des Umzugs der Universität nach Landshut im Jahre 1800 wirkte die Stadt wie eine<br />
niederbayerisch-gemütliche Bauernstadt, umgeben von Kirchen und Klöstern, bestanden<br />
von Wirtshäusern und Brauereien, erfüllt vom Biedersinn und Handwerksfleiß… zudem<br />
noch sehr wehrhaft und in sich geschlossen; sie war von einer Stadtmauer mit Türmen<br />
umgeben, hölzerne Wehrgänge und Befestigungsanlagen sowie sieben bewachte<br />
Stadttore vervollständigten diesen Eindruck. Vor den Stadtmauern befanden sich noch<br />
wassergefüllte Doppelgräben ohne Zuflüsse, die im Laufe der Zeit zu sumpfigen Tümpeln<br />
mutierten und bei heißem Sommerklima üble Gerüche abgaben.<br />
Bei Eintritt in die Stadt, zumal mit Handelswaren, waren Ausweispflicht und die<br />
Entrichtung der städtischen Gefälle an den Torschreiber obligatorisch. Soldaten des 6.<br />
Infanterielinienregiments Herzog-Wilhelm oblag die Bewachung der Tore. Zwei<br />
Wahrzeichen der Stadt waren bereits bei der Annäherung an dieselbe wahrnehmbar, die<br />
Burg Trausnitz auf einer Anhöhe gelgen, sowie „der spätgotische Backsteinbau von Sankt<br />
Martin mit seinem Westportal und seinem hochragenden Turm“ 99 . Im Verlauf des 19.<br />
Jahrhunderts erfuhr das innere Stadtbild insofern Veränderungen, als im Zuge der<br />
Säkularisation die ehemals im Klosterbesitz sich befindenden Kirchen abgerissen wurden.<br />
Noch fehlten die „unschönen“ Bauten des 19. Jahrhunderts und eine durchgängige<br />
Straßenpflasterung (nur die Altstadt wies eine solche auf), die einheitliche Front der<br />
Giebeldächer war noch nicht durch die charakteristischen Bauten Johan Baptist<br />
Bernlochners mit ihren Walmdächern durchbrochen, zudem zierten noch steinerne<br />
Brunnen das Bild der Stadt. Aufgelassen wurden auch die Pfarrfriedhöfe um die großen<br />
Kirchen herum. Den Veränderungen des 19. Jahrhunderts fielen auch die barocke Pracht<br />
der Kircheninnenräume sowie die barocke Fassade des Rathauses zum Opfer. 100<br />
Das mittelalterliche Stadtbild scheint vorab die ideale Kulisse für die Herausbildung der<br />
romantischen Gegenbewegung abgegeben haben, wie aus den unterschiedlichen<br />
Schilderungen zu erkennen ist, und die Beschreibung der Universitätsstadt besitzt hier<br />
offenbar auffallende Parallelen etwa zu Heidelberg und dessen geistiger Entwicklung.<br />
Bei allen auffälligen Übereinstimmungen zeigt die auch schon von Zeitgenossen<br />
wiederholt beobachtete „Provinzialität“ das Eingebettet-Sein der kleinen Stadt im<br />
„Barbarenland“ die entscheidende Differenz zu Heidelberg.<br />
99<br />
100<br />
Platen in seinem Tagebuch aus dem Jahre 1824 zitiert bei Hornung, Alois: Landshut. Das Bild einer<br />
Stadt in Auszügen aus dem Schrifttum Goethes, Bettinens und der Romantik. S.20. München 1949<br />
vgl. Herzog, Theo: Landshut 1969, S.9-12