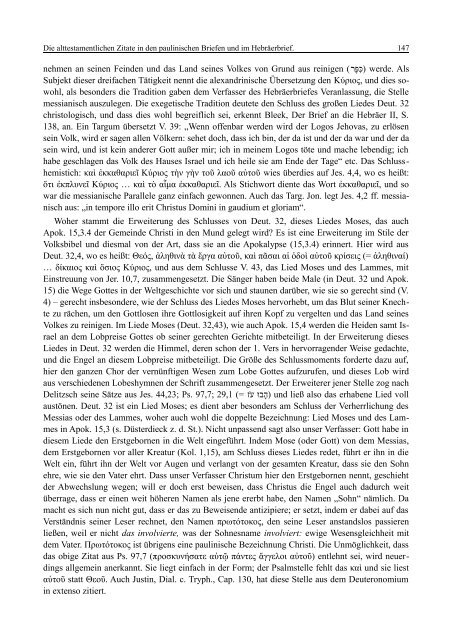alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> in den paulinischen Briefen <strong>und</strong> im Hebräerbrief. 147<br />
nehmen an seinen Feinden <strong>und</strong> das Land seines Volkes von Gr<strong>und</strong> aus reinigen (רùפãכ) werde. Als<br />
Subjekt dieser dreifachen Tätigkeit nennt die alexandrinische Übersetzung den Κύριος, <strong>und</strong> dies sowohl,<br />
als besonders die Tradition gaben dem Verfasser des Hebräerbriefes Veranlassung, die Stelle<br />
messianisch auszulegen. Die exegetische Tradition deutete den Schluss des großen Liedes Deut. 32<br />
christologisch, <strong>und</strong> dass dies wohl begreiflich sei, erkennt Bleek, Der Brief an die Hebräer II, S.<br />
138, an. Ein Targum übersetzt V. 39: „Wenn offenbar werden wird der Logos Jehovas, zu erlösen<br />
sein Volk, wird er sagen allen Völkern: sehet doch, dass ich bin, der da ist <strong>und</strong> der da war <strong>und</strong> der da<br />
sein wird, <strong>und</strong> ist kein anderer Gott außer mir; ich in meinem Logos töte <strong>und</strong> mache lebendig; ich<br />
habe geschlagen das Volk des Hauses Israel <strong>und</strong> ich heile sie am Ende der Tage“ etc. Das Schlusshemistich:<br />
καὶ ἐκκαθαριεῖ Κύριος τὴν γὴν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ wies überdies auf Jes. 4,4, wo es heißt:<br />
ὅτι ἐκπλυνεῖ Κύριος … καὶ τὸ αἷμα ἐκκαθαριεῖ. Als Stichwort diente das Wort ἐκκαθαριεῖ, <strong>und</strong> so<br />
war die messianische Parallele ganz einfach gewonnen. Auch das Targ. Jon. legt Jes. 4,2 ff. messianisch<br />
aus: „in tempore illo erit Christus Domini in gaudium et gloriam“.<br />
Woher stammt die Erweiterung des Schlusses von Deut. 32, dieses Liedes Moses, das auch<br />
Apok. 15,3.4 der Gemeinde Christi in den M<strong>und</strong> gelegt wird? Es ist eine Erweiterung im Stile der<br />
Volksbibel <strong>und</strong> diesmal von der Art, dass sie an die Apokalypse (15,3.4) erinnert. Hier wird aus<br />
Deut. 32,4, wo es heißt: Θεός, ἀληθινὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ, καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ κρίσεις (= ἀληθιναί)<br />
… δίκαιος καὶ ὅσιος Κύριος, <strong>und</strong> aus dem Schlusse V. 43, das Lied Moses <strong>und</strong> des Lammes, mit<br />
Einstreuung von Jer. 10,7, zusammengesetzt. Die Sänger haben beide Male (in Deut. 32 <strong>und</strong> Apok.<br />
15) die Wege Gottes in der Weltgeschichte vor sich <strong>und</strong> staunen darüber, wie sie so gerecht sind (V.<br />
4) – gerecht insbesondere, wie der Schluss des Liedes Moses hervorhebt, um das Blut seiner Knechte<br />
zu rächen, um den Gottlosen ihre Gottlosigkeit auf ihren Kopf zu vergelten <strong>und</strong> das Land seines<br />
Volkes zu reinigen. Im Liede Moses (Deut. 32,43), wie auch Apok. 15,4 werden die Heiden samt Israel<br />
an dem Lobpreise Gottes ob seiner gerechten Gerichte mitbeteiligt. In der Erweiterung dieses<br />
Liedes in Deut. 32 werden die Himmel, deren schon der 1. Vers in hervorragender Weise gedachte,<br />
<strong>und</strong> die Engel an diesem Lobpreise mitbeteiligt. Die Größe des Schlussmoments forderte dazu auf,<br />
hier den ganzen Chor der vernünftigen Wesen zum Lobe Gottes aufzurufen, <strong>und</strong> dieses Lob wird<br />
aus verschiedenen Lobeshymnen der Schrift zusammengesetzt. Der Erweiterer jener Stelle zog nach<br />
Delitzsch seine Sätze aus Jes. 44,23; Ps. 97,7; 29,1 (= זé ע ובה) <strong>und</strong> ließ also das erhabene Lied voll<br />
austönen. Deut. 32 ist ein Lied Moses; es dient aber besonders am Schluss der Verherrlichung des<br />
Messias oder des Lammes, woher auch wohl die doppelte Bezeichnung: Lied Moses <strong>und</strong> des Lammes<br />
in Apok. 15,3 (s. Düsterdieck z. d. St.). Nicht unpassend sagt also unser Verfasser: Gott habe in<br />
diesem Liede den Erstgebornen in die Welt eingeführt. Indem Mose (oder Gott) von dem Messias,<br />
dem Erstgebornen vor aller Kreatur (Kol. 1,15), am Schluss dieses Liedes redet, führt er ihn in die<br />
Welt ein, führt ihn der Welt vor Augen <strong>und</strong> verlangt von der gesamten Kreatur, dass sie den Sohn<br />
ehre, wie sie den Vater ehrt. Dass unser Verfasser Christum hier den Erstgebornen nennt, geschieht<br />
der Abwechslung wegen; will er doch erst beweisen, dass Christus die Engel auch dadurch weit<br />
überrage, dass er einen weit höheren Namen als jene ererbt habe, den Namen „Sohn“ nämlich. Da<br />
macht es sich nun nicht gut, dass er das zu Beweisende antizipiere; er setzt, indem er dabei auf das<br />
Verständnis seiner Leser rechnet, den Namen πρωτότοκος, den seine Leser anstandslos passieren<br />
ließen, weil er nicht das involvierte, was der Sohnesname involviert: ewige Wesensgleichheit mit<br />
dem Vater. Πρωτότοκος ist übrigens eine paulinische Bezeichnung Christi. Die Unmöglichkeit, dass<br />
das obige Zitat aus Ps. 97,7 (προσκυνήσατε αὐτῷ πάντες ἄγγελοι αὐτοῦ) entlehnt sei, wird neuerdings<br />
allgemein anerkannt. Sie liegt einfach in der Form; der Psalmstelle fehlt das καὶ <strong>und</strong> sie liest<br />
αὐτοῦ statt Θεοῦ. Auch Justin, Dial. c. Tryph., Cap. 130, hat diese Stelle aus dem Deuteronomium<br />
in extenso zitiert.