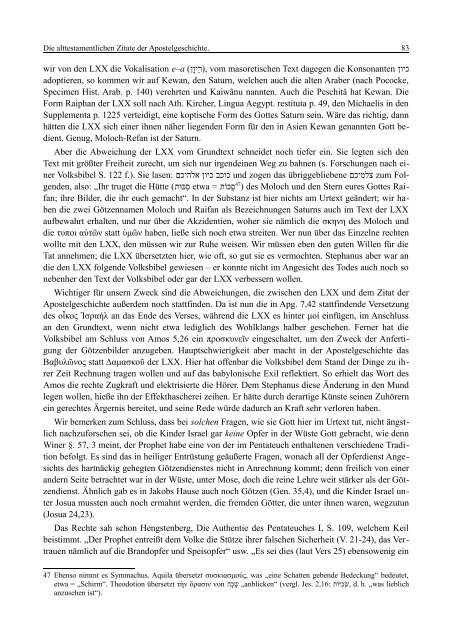alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> der Apostelgeschichte. 83<br />
wir von den LXX die Vokalisation e–a (ןויtר), vom masoretischen Text dagegen die Konsonanten ןויכ<br />
adoptieren, so kommen wir auf Kewan, den Saturn, welchen auch die alten Araber (nach Pococke,<br />
Specimen Hist. Arab. p. 140) verehrten <strong>und</strong> Kaiwânu nannten. Auch die Peschitâ hat Kewan. Die<br />
Form Raiphan der LXX soll nach Ath. Kircher, Lingua Aegypt. restituta p. 49, den Michaelis in den<br />
Supplementa p. 1225 verteidigt, eine koptische Form des Gottes Saturn sein. Wäre das richtig, dann<br />
hätten die LXX sich einer ihnen näher liegenden Form für den in Asien Kewan genannten Gott bedient.<br />
Genug, Moloch-Refan ist der Saturn.<br />
Aber die Abweichung der LXX vom Gr<strong>und</strong>text schneidet noch tiefer ein. Sie legten sich den<br />
Text mit größter Freiheit zurecht, um sich nur irgendeinen Weg zu bahnen (s. Forschungen nach einer<br />
Volksbibel S. 122 f.). Sie lasen: םכיהלא ןויכ בכוכ <strong>und</strong> zogen das übriggebliebene םכימלצ zum Folgenden,<br />
also: „Ihr truget die Hütte (תוכãס etwa = תוכÛס 47 ) des Moloch <strong>und</strong> den Stern eures Gottes Raifan;<br />
ihre Bilder, die ihr euch gemacht“. In der Substanz ist hier nichts am Urtext geändert; wir haben<br />
die zwei Götzennamen Moloch <strong>und</strong> Raifan als Bezeichnungen Saturns auch im Text der LXX<br />
aufbewahrt erhalten, <strong>und</strong> nur über die Akzidentien, woher sie nämlich die σκηνη des Moloch <strong>und</strong><br />
die τυποι αὐτῶν statt ὑμῶν haben, ließe sich noch etwa streiten. Wer nun über das Einzelne rechten<br />
wollte mit den LXX, den müssen wir zur Ruhe weisen. Wir müssen eben den guten Willen für die<br />
Tat annehmen; die LXX übersetzten hier, wie oft, so gut sie es vermochten. Stephanus aber war an<br />
die den LXX folgende Volksbibel gewiesen – er konnte nicht im Angesicht des Todes auch noch so<br />
nebenher den Text der Volksbibel oder gar der LXX verbessern wollen.<br />
Wichtiger für unsern Zweck sind die Abweichungen, die zwischen den LXX <strong>und</strong> dem Zitat der<br />
Apostelgeschichte außerdem noch stattfinden. Da ist nun die in Apg. 7,42 stattfindende Versetzung<br />
des οἶκος Ἰσραήλ an das Ende des Verses, während die LXX es hinter μοί einfügen, im Anschluss<br />
an den Gr<strong>und</strong>text, wenn nicht etwa lediglich des Wohlklangs halber geschehen. Ferner hat die<br />
Volksbibel am Schluss von Amos 5,26 ein προσκυνεῖν eingeschaltet, um den Zweck der Anfertigung<br />
der Götzenbilder anzugeben. Hauptschwierigkeit aber macht in der Apostelgeschichte das<br />
Βαβυλῶνος statt Δαμασκοῦ der LXX. Hier hat offenbar die Volksbibel dem Stand der Dinge zu ihrer<br />
Zeit Rechnung tragen wollen <strong>und</strong> auf das babylonische Exil reflektiert. So erhielt das Wort des<br />
Amos die rechte Zugkraft <strong>und</strong> elektrisierte die Hörer. Dem Stephanus diese Änderung in den M<strong>und</strong><br />
legen wollen, hieße ihn der Effekthascherei zeihen. Er hätte durch derartige Künste seinen Zuhörern<br />
ein gerechtes Ärgernis bereitet, <strong>und</strong> seine Rede würde dadurch an Kraft sehr verloren haben.<br />
Wir bemerken zum Schluss, dass bei solchen Fragen, wie sie Gott hier im Urtext tut, nicht ängstlich<br />
nachzuforschen sei, ob die Kinder Israel gar keine Opfer in der Wüste Gott gebracht, wie denn<br />
Winer §. 57, 3 meint, der Prophet habe eine von der im Pentateuch enthaltenen verschiedene Tradition<br />
befolgt. Es sind das in heiliger Entrüstung geäußerte Fragen, wonach all der Opferdienst Angesichts<br />
des hartnäckig gehegten Götzendienstes nicht in Anrechnung kommt; denn freilich von einer<br />
andern Seite betrachtet war in der Wüste, unter Mose, doch die reine Lehre weit stärker als der Götzendienst.<br />
Ähnlich gab es in Jakobs Hause auch noch Götzen (Gen. 35,4), <strong>und</strong> die Kinder Israel unter<br />
Josua mussten auch noch ermahnt werden, die fremden Götter, die unter ihnen waren, wegzutun<br />
(Josua 24,23).<br />
Das <strong>Recht</strong>e sah schon Hengstenberg, Die Authentie des Pentateuches I, S. 109, welchem Keil<br />
beistimmt. „Der Prophet entreißt dem Volke die Stütze ihrer falschen Sicherheit (V. 21-24), das Vertrauen<br />
nämlich auf die Brandopfer <strong>und</strong> Speisopfer“ usw. „Es sei dies (laut Vers 25) ebensowenig ein<br />
47 Ebenso nimmt es Symmachus. Aquila übersetzt συσκιασμούς, was „eine Schatten gebende Bedeckung“ bedeutet,<br />
etwa = „Schirm“. Theodotion übersetzt τὴν ὅρασιν von הכש „anblicken“ (vergl. Jes. 2,16: תויãכxש, d. h. „was lieblich<br />
anzusehen ist“).