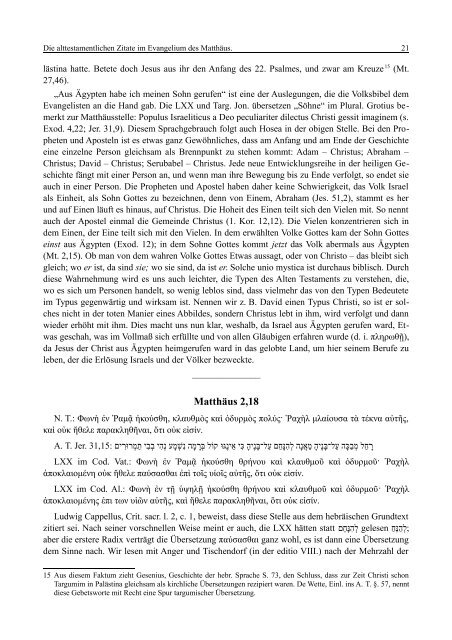alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> im Evangelium des Matthäus. 21<br />
lästina hatte. Betete doch Jesus aus ihr den Anfang des 22. Psalmes, <strong>und</strong> zwar am Kreuze 15 (Mt.<br />
27,46).<br />
„Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen“ ist eine der Auslegungen, die die Volksbibel dem<br />
Evangelisten an die Hand gab. Die LXX <strong>und</strong> Targ. Jon. übersetzen „Söhne“ im Plural. Grotius bemerkt<br />
zur Matthäusstelle: Populus Israeliticus a Deo peculiariter dilectus Christi gessit imaginem (s.<br />
Exod. 4,22; Jer. 31,9). Diesem Sprachgebrauch folgt auch Hosea in der obigen Stelle. Bei den Propheten<br />
<strong>und</strong> Aposteln ist es etwas ganz Gewöhnliches, dass am Anfang <strong>und</strong> am Ende der Geschichte<br />
eine einzelne Person gleichsam als Brennpunkt zu stehen kommt: Adam – Christus; Abraham –<br />
Christus; David – Christus; Serubabel – Christus. Jede neue Entwicklungsreihe in der heiligen Geschichte<br />
fängt mit einer Person an, <strong>und</strong> wenn man ihre Bewegung bis zu Ende verfolgt, so endet sie<br />
auch in einer Person. Die Propheten <strong>und</strong> Apostel haben daher keine Schwierigkeit, das Volk Israel<br />
als Einheit, als Sohn Gottes zu bezeichnen, denn von Einem, Abraham (Jes. 51,2), stammt es her<br />
<strong>und</strong> auf Einen läuft es hinaus, auf Christus. Die Hoheit des Einen teilt sich den Vielen mit. So nennt<br />
auch der Apostel einmal die Gemeinde Christus (1. Kor. 12,12). Die Vielen konzentrieren sich in<br />
dem Einen, der Eine teilt sich mit den Vielen. In dem erwählten Volke Gottes kam der Sohn Gottes<br />
einst aus Ägypten (Exod. 12); in dem Sohne Gottes kommt jetzt das Volk abermals aus Ägypten<br />
(Mt. 2,15). Ob man von dem wahren Volke Gottes Etwas aussagt, oder von Christo – das bleibt sich<br />
gleich; wo er ist, da sind sie; wo sie sind, da ist er. Solche unio mystica ist durchaus biblisch. Durch<br />
diese Wahrnehmung wird es uns auch leichter, die Typen des Alten <strong>Testament</strong>s zu verstehen, die,<br />
wo es sich um Personen handelt, so wenig leblos sind, dass vielmehr das von den Typen Bedeutete<br />
im Typus gegenwärtig <strong>und</strong> wirksam ist. Nennen wir z. B. David einen Typus Christi, so ist er solches<br />
nicht in der toten Manier eines Abbildes, sondern Christus lebt in ihm, wird verfolgt <strong>und</strong> dann<br />
wieder erhöht mit ihm. Dies macht uns nun klar, weshalb, da Israel aus Ägypten gerufen ward, Etwas<br />
geschah, was im Vollmaß sich erfüllte <strong>und</strong> von allen Gläubigen erfahren wurde (d. i. πληρωθῇ),<br />
da Jesus der Christ aus Ägypten heimgerufen ward in das gelobte Land, um hier seinem Berufe zu<br />
leben, der die Erlösung Israels <strong>und</strong> der Völker bezweckte.<br />
_______________<br />
Matthäus 2,18<br />
N. T.: Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ μλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς,<br />
καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.<br />
A. T. Jer. 31,15: םי ãרורxמÅת יãבxב יãהxנ עמxשãנ המרxב לוק וגùניtא יãכ היùנב־לÅע םtחנãהxל הנòאtמ היùנב־לÅע הכÅבxמ לtחר<br />
LXX im Cod. Vat.: Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ· Ῥαχὴλ<br />
ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελε παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υίοῖς αὐτῆς, ὅτι οὐκ εἰσίν.<br />
LXX im Cod. Al.: Φωνὴ ἐν τῇ ὑψηλῇ ἠκούσθη θρήνου καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ· Ῥαχὴλ<br />
ἀποκλαιομένης ἐπι των υἱῶν αὐτῆς, καὶ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.<br />
Ludwig Cappellus, Crit. sacr. l. 2, c. 1, beweist, dass diese Stelle aus dem hebräischen Gr<strong>und</strong>text<br />
zitiert sei. Nach seiner vorschnellen Weise meint er auch, die LXX hätten statt םtחנãהxל gelesen ÅחtנÅהxל;<br />
aber die erstere Radix verträgt die Übersetzung παύσασθαι ganz wohl, es ist dann eine Übersetzung<br />
dem Sinne nach. Wir lesen mit Anger <strong>und</strong> Tischendorf (in der editio VIII.) nach der Mehrzahl der<br />
15 Aus diesem Faktum zieht Gesenius, Geschichte der hebr. Sprache S. 73, den Schluss, dass zur Zeit Christi schon<br />
Targumim in Palästina gleichsam als kirchliche Übersetzungen rezipiert waren. De Wette, Einl. ins A. T. §. 57, nennt<br />
diese Gebetsworte mit <strong>Recht</strong> eine Spur targumischer Übersetzung.