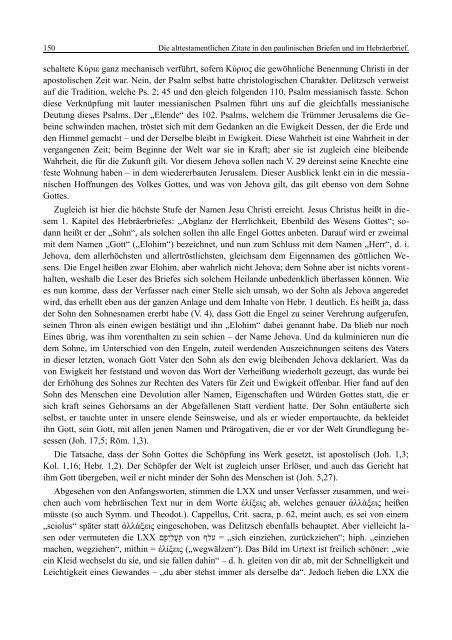alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
150 Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> in den paulinischen Briefen <strong>und</strong> im Hebräerbrief.<br />
schaltete Κύριε ganz mechanisch verführt, sofern Κύριος die gewöhnliche Benennung Christi in der<br />
apostolischen Zeit war. Nein, der Psalm selbst hatte christologischen Charakter. Delitzsch verweist<br />
auf die Tradition, welche Ps. 2; 45 <strong>und</strong> den gleich folgenden 110. Psalm messianisch fasste. Schon<br />
diese Verknüpfung mit lauter messianischen Psalmen führt uns auf die gleichfalls messianische<br />
Deutung dieses Psalms. Der „Elende“ des 102. Psalms, welchem die Trümmer Jerusalems die Gebeine<br />
schwinden machen, tröstet sich mit dem Gedanken an die Ewigkeit Dessen, der die Erde <strong>und</strong><br />
den Himmel gemacht – <strong>und</strong> der Derselbe bleibt in Ewigkeit. Diese Wahrheit ist eine Wahrheit in der<br />
vergangenen Zeit; beim Beginne der Welt war sie in Kraft; aber sie ist zugleich eine bleibende<br />
Wahrheit, die für die Zukunft gilt. Vor diesem Jehova sollen nach V. 29 dereinst seine Knechte eine<br />
feste Wohnung haben – in dem wiedererbauten Jerusalem. Dieser Ausblick lenkt ein in die messianischen<br />
Hoffnungen des Volkes Gottes, <strong>und</strong> was von Jehova gilt, das gilt ebenso von dem Sohne<br />
Gottes.<br />
Zugleich ist hier die höchste Stufe der Namen Jesu Christi erreicht. Jesus Christus heißt in diesem<br />
1. Kapitel des Hebräerbriefes: „Abglanz der Herrlichkeit, Ebenbild des Wesens Gottes“; sodann<br />
heißt er der „Sohn“, als solchen sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Darauf wird er zweimal<br />
mit dem Namen „Gott“ („Elohim“) bezeichnet, <strong>und</strong> nun zum Schluss mit dem Namen „Herr“, d. i.<br />
Jehova, dem allerhöchsten <strong>und</strong> allertröstlichsten, gleichsam dem Eigennamen des göttlichen Wesens.<br />
Die Engel heißen zwar Elohim, aber wahrlich nicht Jehova; dem Sohne aber ist nichts vorenthalten,<br />
weshalb die Leser des Briefes sich solchem Heilande unbedenklich überlassen können. Wie<br />
es nun komme, dass der Verfasser nach einer Stelle sich umsah, wo der Sohn als Jehova angeredet<br />
wird, das erhellt eben aus der ganzen Anlage <strong>und</strong> dem Inhalte von Hebr. 1 deutlich. Es heißt ja, dass<br />
der Sohn den Sohnesnamen ererbt habe (V. 4), dass Gott die Engel zu seiner Verehrung aufgerufen,<br />
seinen Thron als einen ewigen bestätigt <strong>und</strong> ihn „Elohim“ dabei genannt habe. Da blieb nur noch<br />
Eines übrig, was ihm vorenthalten zu sein schien – der Name Jehova. Und da kulminieren nun die<br />
dem Sohne, im Unterschied von den Engeln, zuteil werdenden Auszeichnungen seitens des Vaters<br />
in dieser letzten, wonach Gott Vater den Sohn als den ewig bleibenden Jehova deklariert. Was da<br />
von Ewigkeit her feststand <strong>und</strong> wovon das Wort der Verheißung wiederholt gezeugt, das wurde bei<br />
der Erhöhung des Sohnes zur <strong>Recht</strong>en des Vaters für Zeit <strong>und</strong> Ewigkeit offenbar. Hier fand auf den<br />
Sohn des Menschen eine Devolution aller Namen, Eigenschaften <strong>und</strong> Würden Gottes statt, die er<br />
sich kraft seines Gehorsams an der Abgefallenen Statt verdient hatte. Der Sohn entäußerte sich<br />
selbst, er tauchte unter in unsere elende Seinsweise, <strong>und</strong> als er wieder emportauchte, da bekleidet<br />
ihn Gott, sein Gott, mit allen jenen Namen <strong>und</strong> Prärogativen, die er vor der Welt Gr<strong>und</strong>legung besessen<br />
(Joh. 17,5; Röm. 1,3).<br />
Die Tatsache, dass der Sohn Gottes die Schöpfung ins Werk gesetzt, ist apostolisch (Joh. 1,3;<br />
Kol. 1,16; Hebr. 1,2). Der Schöpfer der Welt ist zugleich unser Erlöser, <strong>und</strong> auch das Gericht hat<br />
ihm Gott übergeben, weil er nicht minder der Sohn des Menschen ist (Joh. 5,27).<br />
Abgesehen von den Anfangsworten, stimmen die LXX <strong>und</strong> unser Verfasser zusammen, <strong>und</strong> weichen<br />
auch vom hebräischen Text nur in dem Worte ἑλίξεις ab, welches genauer ἀλλάξεις heißen<br />
müsste (so auch Symm. <strong>und</strong> Theodot.). Cappellus, Crit. sacra, p. 62, meint auch, es sei von einem<br />
„sciolus“ später statt ἀλλάξεις eingeschoben, was Delitzsch ebenfalls behauptet. Aber vielleicht lasen<br />
oder vermuteten die LXX םtפיãלòעÅת von ףלע = „sich einziehen, zurückziehen“; hiph. „einziehen<br />
machen, wegziehen“, mithin = ἑλίξεις („wegwälzen“). Das Bild im Urtext ist freilich schöner: „wie<br />
ein Kleid wechselst du sie, <strong>und</strong> sie fallen dahin“ – d. h. gleiten von dir ab, mit der Schnelligkeit <strong>und</strong><br />
Leichtigkeit eines Gewandes – „du aber stehst immer als derselbe da“. Jedoch lieben die LXX die