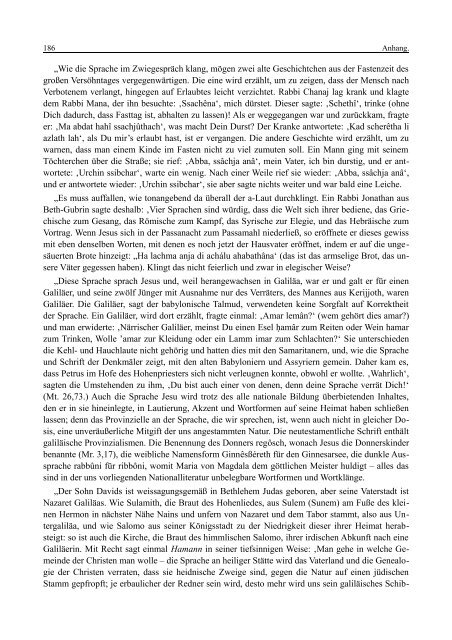alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
186 Anhang.<br />
„Wie die Sprache im Zwiegespräch klang, mögen zwei alte Geschichtchen aus der Fastenzeit des<br />
großen Versöhntages vergegenwärtigen. Die eine wird erzählt, um zu zeigen, dass der Mensch nach<br />
Verbotenem verlangt, hingegen auf Erlaubtes leicht verzichtet. Rabbi Chanaj lag krank <strong>und</strong> klagte<br />
dem Rabbi Mana, der ihn besuchte: ‚Ssachêna‘, mich dürstet. Dieser sagte: ‚Schethî‘, trinke (ohne<br />
Dich dadurch, dass Fasttag ist, abhalten zu lassen)! Als er weggegangen war <strong>und</strong> zurückkam, fragte<br />
er: ‚Ma abdat hahî ssachjûthach‘, was macht Dein Durst? Der Kranke antwortete: ‚Kad scherêtha li<br />
azlath lah‘, als Du mir’s erlaubt hast, ist er vergangen. Die andere Geschichte wird erzählt, um zu<br />
warnen, dass man einem Kinde im Fasten nicht zu viel zumuten soll. Ein Mann ging mit seinem<br />
Töchterchen über die Straße; sie rief: ‚Abba, ssâchja anâ‘, mein Vater, ich bin durstig, <strong>und</strong> er antwortete:<br />
‚Urchin ssibchar‘, warte ein wenig. Nach einer Weile rief sie wieder: ‚Abba, ssâchja anâ‘,<br />
<strong>und</strong> er antwortete wieder: ‚Urchin ssibchar‘, sie aber sagte nichts weiter <strong>und</strong> war bald eine Leiche.<br />
„Es muss auffallen, wie tonangebend da überall der a-Laut durchklingt. Ein Rabbi Jonathan aus<br />
Beth-Gubrin sagte deshalb: ‚Vier Sprachen sind würdig, dass die Welt sich ihrer bediene, das Griechische<br />
zum Gesang, das Römische zum Kampf, das Syrische zur Elegie, <strong>und</strong> das Hebräische zum<br />
Vortrag. Wenn Jesus sich in der Passanacht zum Passamahl niederließ, so eröffnete er dieses gewiss<br />
mit eben denselben Worten, mit denen es noch jetzt der Hausvater eröffnet, indem er auf die ungesäuerten<br />
Brote hinzeigt: „Ha lachma anja di achálu ahabathâna‘ (das ist das armselige Brot, das unsere<br />
Väter gegessen haben). Klingt das nicht feierlich <strong>und</strong> zwar in elegischer Weise?<br />
„Diese Sprache sprach Jesus <strong>und</strong>, weil herangewachsen in Galiläa, war er <strong>und</strong> galt er für einen<br />
Galiläer, <strong>und</strong> seine zwölf Jünger mit Ausnahme nur des Verräters, des Mannes aus Kerijjoth, waren<br />
Galiläer. Die Galiläer, sagt der babylonische Talmud, verwendeten keine Sorgfalt auf Korrektheit<br />
der Sprache. Ein Galiläer, wird dort erzählt, fragte einmal: ‚Amar lemân?‘ (wem gehört dies amar?)<br />
<strong>und</strong> man erwiderte: ‚Närrischer Galiläer, meinst Du einen Esel ḥamâr zum Reiten oder Wein hamar<br />
zum Trinken, Wolle ’amar zur Kleidung oder ein Lamm imar zum Schlachten?‘ Sie unterschieden<br />
die Kehl- <strong>und</strong> Hauchlaute nicht gehörig <strong>und</strong> hatten dies mit den Samaritanern, <strong>und</strong>, wie die Sprache<br />
<strong>und</strong> Schrift der Denkmäler zeigt, mit den alten Babyloniern <strong>und</strong> Assyriern gemein. Daher kam es,<br />
dass Petrus im Hofe des Hohenpriesters sich nicht verleugnen konnte, obwohl er wollte. ‚Wahrlich‘,<br />
sagten die Umstehenden zu ihm, ‚Du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät Dich!‘<br />
(Mt. 26,73.) Auch die Sprache Jesu wird trotz des alle nationale Bildung überbietenden Inhaltes,<br />
den er in sie hineinlegte, in Lautierung, Akzent <strong>und</strong> Wortformen auf seine Heimat haben schließen<br />
lassen; denn das Provinzielle an der Sprache, die wir sprechen, ist, wenn auch nicht in gleicher Dosis,<br />
eine unveräußerliche Mitgift der uns angestammten Natur. Die neutestamentliche Schrift enthält<br />
galiläische Provinzialismen. Die Benennung des Donners regôsch, wonach Jesus die Donnerskinder<br />
benannte (Mr. 3,17), die weibliche Namensform Ginnêsßéreth für den Ginnesarsee, die dunkle Aussprache<br />
rabbûni für ribbôni, womit Maria von Magdala dem göttlichen Meister huldigt – alles das<br />
sind in der uns vorliegenden Nationalliteratur unbelegbare Wortformen <strong>und</strong> Wortklänge.<br />
„Der Sohn Davids ist weissagungsgemäß in Bethlehem Judas geboren, aber seine Vaterstadt ist<br />
Nazaret Galiläas. Wie Sulamith, die Braut des Hohenliedes, aus Sulem (Sunem) am Fuße des kleinen<br />
Hermon in nächster Nähe Nains <strong>und</strong> unfern von Nazaret <strong>und</strong> dem Tabor stammt, also aus Untergaliläa,<br />
<strong>und</strong> wie Salomo aus seiner Königsstadt zu der Niedrigkeit dieser ihrer Heimat herabsteigt:<br />
so ist auch die Kirche, die Braut des himmlischen Salomo, ihrer irdischen Abkunft nach eine<br />
Galiläerin. Mit <strong>Recht</strong> sagt einmal Hamann in seiner tiefsinnigen Weise: ‚Man gehe in welche Gemeinde<br />
der Christen man wolle – die Sprache an heiliger Stätte wird das Vaterland <strong>und</strong> die Genealogie<br />
der Christen verraten, dass sie heidnische Zweige sind, gegen die Natur auf einen jüdischen<br />
Stamm gepfropft; je erbaulicher der Redner sein wird, desto mehr wird uns sein galiläisches Schib-