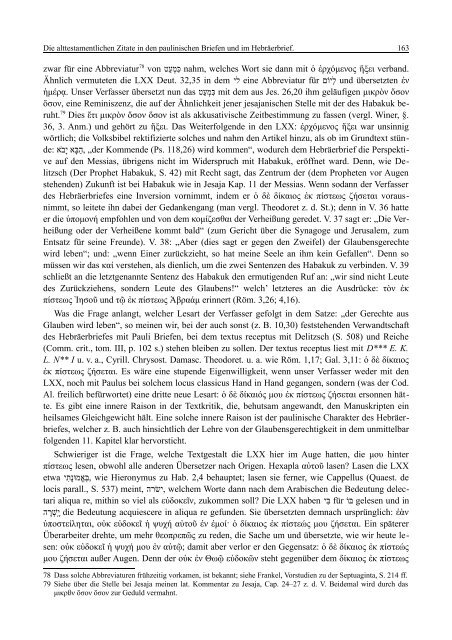alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
alttestamentlichen Zitate Neuen Testament. - Licht und Recht
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die <strong>alttestamentlichen</strong> <strong>Zitate</strong> in den paulinischen Briefen <strong>und</strong> im Hebräerbrief. 163<br />
zwar für eine Abbreviatur 78 von טÅעxמãכ nahm, welches Wort sie dann mit ὁ ἐρχόμενος ἥξει verband.<br />
Ähnlich vermuteten die LXX Deut. 32,35 in dem יל eine Abbreviatur für םויxל <strong>und</strong> übersetzten ἐν<br />
ἡμέρᾳ. Unser Verfasser übersetzt nun das טÅעxמãכ mit dem aus Jes. 26,20 ihm geläufigen μικρὸν ὅσον<br />
ὅσον, eine Reminiszenz, die auf der Ähnlichkeit jener jesajanischen Stelle mit der des Habakuk beruht.<br />
79 Dies ἔτι μικρὸν ὅσον ὅσον ist als akkusativische Zeitbestimmung zu fassen (vergl. Winer, §.<br />
36, 3. Anm.) <strong>und</strong> gehört zu ἥξει. Das Weiterfolgende in den LXX: ἐρχόμενος ἥξει war unsinnig<br />
wörtlich; die Volksbibel rektifizierte solches <strong>und</strong> nahm den Artikel hinzu, als ob im Gr<strong>und</strong>text stünde:<br />
אé בי אבÅה, „der Kommende (Ps. 118,26) wird kommen“, wodurch dem Hebräerbrief die Perspektive<br />
auf den Messias, übrigens nicht im Widerspruch mit Habakuk, eröffnet ward. Denn, wie Delitzsch<br />
(Der Prophet Habakuk, S. 42) mit <strong>Recht</strong> sagt, das Zentrum der (dem Propheten vor Augen<br />
stehenden) Zukunft ist bei Habakuk wie in Jesaja Kap. 11 der Messias. Wenn sodann der Verfasser<br />
des Hebräerbriefes eine Inversion vornimmt, indem er ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται vorausnimmt,<br />
so leitete ihn dabei der Gedankengang (man vergl. Theodoret z. d. St.); denn in V. 36 hatte<br />
er die ὑπομονή empfohlen <strong>und</strong> von dem κομίζεσθαι der Verheißung geredet. V. 37 sagt er: „Die Verheißung<br />
oder der Verheißene kommt bald“ (zum Gericht über die Synagoge <strong>und</strong> Jerusalem, zum<br />
Entsatz für seine Fre<strong>und</strong>e). V. 38: „Aber (dies sagt er gegen den Zweifel) der Glaubensgerechte<br />
wird leben“; <strong>und</strong>: „wenn Einer zurückzieht, so hat meine Seele an ihm kein Gefallen“. Denn so<br />
müssen wir das καί verstehen, als dienlich, um die zwei Sentenzen des Habakuk zu verbinden. V. 39<br />
schließt an die letztgenannte Sentenz des Habakuk den ermutigenden Ruf an: „wir sind nicht Leute<br />
des Zurückziehens, sondern Leute des Glaubens!“ welch’ letzteres an die Ausdrücke: τὸν ἐκ<br />
πίστεως Ἰησοῦ <strong>und</strong> τῷ ἐκ πίστεως Ἀβραάμ erinnert (Röm. 3,26; 4,16).<br />
Was die Frage anlangt, welcher Lesart der Verfasser gefolgt in dem Satze: „der Gerechte aus<br />
Glauben wird leben“, so meinen wir, bei der auch sonst (z. B. 10,30) feststehenden Verwandtschaft<br />
des Hebräerbriefes mit Pauli Briefen, bei dem textus receptus mit Delitzsch (S. 508) <strong>und</strong> Reiche<br />
(Comm. crit., tom. III, p. 102 s.) stehen bleiben zu sollen. Der textus receptus liest mit D*** E. K.<br />
L. N** I u. v. a., Cyrill. Chrysost. Damasc. Theodoret. u. a. wie Röm. 1,17; Gal. 3,11: ὁ δὲ δίκαιος<br />
ἐκ πίστεως ζήσεται. Es wäre eine stupende Eigenwilligkeit, wenn unser Verfasser weder mit den<br />
LXX, noch mit Paulus bei solchem locus classicus Hand in Hand gegangen, sondern (was der Cod.<br />
Al. freilich befürwortet) eine dritte neue Lesart: ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται ersonnen hätte.<br />
Es gibt eine innere Raison in der Textkritik, die, behutsam angewandt, den Manuskripten ein<br />
heilsames Gleichgewicht hält. Eine solche innere Raison ist der paulinische Charakter des Hebräerbriefes,<br />
welcher z. B. auch hinsichtlich der Lehre von der Glaubensgerechtigkeit in dem unmittelbar<br />
folgenden 11. Kapitel klar hervorsticht.<br />
Schwieriger ist die Frage, welche Textgestalt die LXX hier im Auge hatten, die μου hinter<br />
πίστεως lesen, obwohl alle anderen Übersetzer nach Origen. Hexapla αὐτοῦ lasen? Lasen die LXX<br />
etwa יãתנומאxב, wie Hieronymus zu Hab. 2,4 behauptet; lasen sie ferner, wie Cappellus (Quaest. de<br />
locis parall., S. 537) meint, הרשי, welchem Worte dann nach dem Arabischen die Bedeutung delectari<br />
aliqua re, mithin so viel als εὐδοκεῖν, zukommen soll? Die LXX haben יãב für וב gelesen <strong>und</strong> in<br />
הרxשfl י die Bedeutung acquiescere in aliqua re gef<strong>und</strong>en. Sie übersetzten demnach ursprünglich: ἐὰν<br />
ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή αὐτοῦ ἐν ἐμοί· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται. Ein späterer<br />
Überarbeiter drehte, um mehr θεοπρεπῶς zu reden, die Sache um <strong>und</strong> übersetzte, wie wir heute lesen:<br />
οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ; damit aber verlor er den Gegensatz: ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς<br />
μου ζήσεται außer Augen. Denn der οὐκ ἐν Θωῷ εὐδοκῶν steht gegenüber dem δίκαιος ἐκ πίστεως<br />
78 Dass solche Abbreviaturen frühzeitig vorkamen, ist bekannt; siehe Frankel, Vorstudien zu der Septuaginta, S. 214 ff.<br />
79 Siehe über die Stelle bei Jesaja meinen lat. Kommentar zu Jesaja, Cap. 24–27 z. d. V. Beidemal wird durch das<br />
μικρßν ὅσον ὅσον zur Geduld vermahnt.