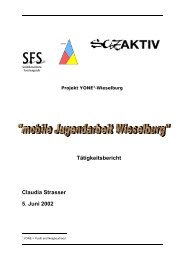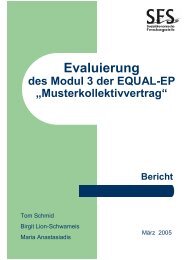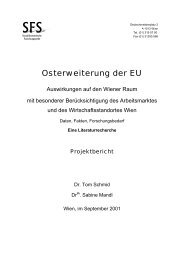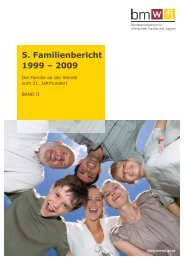Evaluierung der 24h-Betreuung - Sozialökonomische ...
Evaluierung der 24h-Betreuung - Sozialökonomische ...
Evaluierung der 24h-Betreuung - Sozialökonomische ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Evaluierung</strong> 24-Stunden-<strong>Betreuung</strong><br />
unterstützt den Befund, was die Einkommensgrenze (die auch nicht in politischer<br />
Diskussion steht) betrifft.<br />
Was die Vermögensgrenze betrifft, ist <strong>der</strong> Befund etwas differenzierter, da einerseits bei<br />
einer erheblichen Zahl älterer Menschen gewisses Barvermögen vorhanden ist, was auch<br />
durch die Volumina <strong>der</strong> Erbschaften belegt wird, und das wird zum Teil auch für pflege- und<br />
betreuungsbedürftige Menschen gelten, wobei hier zu bedenken ist, dass die Pflegesituation<br />
wahrscheinlich bei Vielen zu einem Abschmelzen großer Barvermögen führt. Daher gilt<br />
an<strong>der</strong>erseits <strong>der</strong> Befund, dass we<strong>der</strong> in den Interviews bzw. in <strong>der</strong> Fragebogenerhebung<br />
noch in den Ablehnungsgründen des BSB die Vermögensgrenze relevant thematisiert wird.<br />
Die (z.B. im ExpertInnenpanel vom 8.7.2008) geäußerte Vermutung, mit Wegfall <strong>der</strong><br />
Vermögensgrenze würde die Zahl <strong>der</strong> Legalisierungen steigen, entbehrt <strong>der</strong> empirischen<br />
Grundlage, da offensichtlich das Legalisierungsverhalten weitgehend unabhängig von <strong>der</strong><br />
Tatsache, ob För<strong>der</strong>ung bezogen wird o<strong>der</strong> nicht, stattfindet (dafür spricht nicht nur <strong>der</strong><br />
große Gap zwischen <strong>der</strong> Zahl <strong>der</strong> legalisierten BetreuerInnen und <strong>der</strong> relativ dazu niedrigen<br />
Zahl <strong>der</strong> För<strong>der</strong>werberinnen, son<strong>der</strong>n auch die Tatsache, dass die Legalisierungszahl in<br />
Bundeslän<strong>der</strong>n mit einer Vermögensgrenze von 7.000,- € relativ zu den demografischen<br />
Parametern des jeweiligen Landes hoch ist (z.B. Oberösterreich, Burgenland). Die Tatsache<br />
<strong>der</strong> hohen För<strong>der</strong>zahl in Nie<strong>der</strong>österreich dürfte unserer Einschätzung nach nicht o<strong>der</strong> nicht<br />
wesentlich durch den Wegfall <strong>der</strong> Vermögensgrenze verursacht sein (sonst gäbe es ja auch<br />
in Vorarlberg deutlich mehr För<strong>der</strong>fälle), son<strong>der</strong>n durch die Tatsache, dass hier auch in <strong>der</strong><br />
Pflegestufe 1 und 2 geför<strong>der</strong>t wird. Auch die politische Performance <strong>der</strong> Landesför<strong>der</strong>ung in<br />
Nie<strong>der</strong>österreich, die sich <strong>der</strong> Landeshauptmann zu einem zentralen politischen Thema<br />
gemacht hat, spielt hie reine Rolle.<br />
Allerdings zeigt das Beispiel des Landes Vorarlberg, wo AntragstellerInnen unterhalb <strong>der</strong><br />
Vermögensgrenze von 7.000,- € und solchen, <strong>der</strong>en angegebenes Barvermögen höher liegt,<br />
dass in diesem Bundesland bei einer grenze des Barvermögens von 7.000,- € etwa ein<br />
Drittel <strong>der</strong> AntragstellerInnen von <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung ausgeschlossen worden wären (Tabelle<br />
dazu siehe weiter vorne). Im Gegensatz zur Einkommensgrenze scheint die<br />
Vermögensgrenze daher schon eine gewisse soziale Relevanz beim Zugang zur För<strong>der</strong>ung<br />
nach § 21b BPGG zu haben. Zusätzlich scheint uns bei dieser Vermögensgrenze auch eine<br />
gewisse psychologische Barriere gegenüber eines För<strong>der</strong>antrages zu bilden, weil<br />
offensichtlich viele ältere Menschen ihre „letzten Rücklagen“ nicht gerne aufdecken, egal ob<br />
sie im Einzelfall ein Barvermögen von mehr als 7.000,- € einschließen o<strong>der</strong> nicht.<br />
10.3.2.3 Der Rahmen: Einkommenssituation von PflegegeldbezieherInnen<br />
Seit Einführung des Pflegegeldes kann immer wie<strong>der</strong> gezeigt werden (siehe z.B. badelt et.al.<br />
1997), dass sich ein Großteil <strong>der</strong> PflegegeldbezieherInnen in den unteren<br />
Einkommenssegmenten befindet. Das hat nicht zuletzt mit <strong>der</strong> Tatsache zu tun, dass zwei<br />
Drittel <strong>der</strong> PflegegeldbezieherInnen Frauen sind, die (vor allem in den heute hochaltrigen<br />
Alterskohorten) über deutlich niedrigere Pensionseinkommen verfügen als gleichaltrige<br />
Männer (siehe BMSG 2003). Daher ist zu erwarten, dass nur ein geringer Teil dieser<br />
Personengruppe die Einkommensgrenze von monatlichen 2.500,- € übersteigt. Auch die<br />
Bildung größerer Barvermögen ist mit geringen Einkommen in <strong>der</strong> Regel nicht leicht zu<br />
Endbericht 164