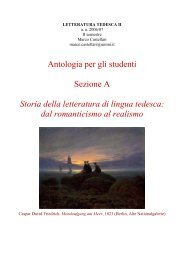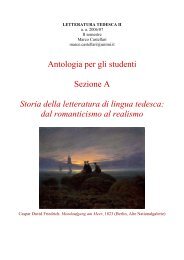Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
126<br />
Walter Obermaier<br />
ken abzulenken. Um aber, wie es <strong>di</strong>e «Instruktion für <strong>di</strong>e Theaterkommissäre<br />
in den Vorstädten von Wien» von 1803 formulierte, «durch fortgesetzte<br />
Maßnahmen der Polizei [...] zu einer öffentlichen Unterhaltung<br />
ohne Gefahr für Kopf, Herz, Sitten und Stimmung des Volkes» 6 zu gelangen,<br />
waren eine Reihe von Maßnahmen erforderlich: Jedes Manuskript<br />
hatte leserlich und korrekt paginiert bei der Zensurbehörde eingereicht zu<br />
werden. Wie es scheint, mußte dazu auch ein “Programm”, also eine Inhaltsangabe<br />
des jeweiligen Stückes, beigelegt werden. 1835 notierte Ernst<br />
Stainhauser, ein eben aus der Provinz ans Theater an der Wien gekommener<br />
Schauspieler, der sich auch als Autor versuchte, in seinem Tagebuch:<br />
Vormittag schrieb mir der H. Sekretär Franz ich möchte das Programm<br />
meines Stückes machen, um es mit demselben der Zensur<br />
Stelle überreichen zu können. 7<br />
Vielleicht sind <strong>di</strong>e Inhaltsangaben, <strong>di</strong>e <strong>Nestroy</strong> etwa für Die verhängnißvolle<br />
Faschings-Nacht (1839) und Der Färber und sein Zwillingsbruder (1840) angelegt<br />
hatte8 , in <strong>di</strong>esem Zusammenhang zu sehen. Es gibt aber auch von<br />
ihm geschriebene Inhaltsangaben zu Stücken, <strong>di</strong>e einzig eine Rolle im<br />
Entstehungsprozess einer Posse spielen und <strong>di</strong>e man als «Entwurfsinhaltsangaben»<br />
bezeichnen könnte, wie bei Der Treulose (1836), Der Erbschleicher<br />
(1840) und Der hollän<strong>di</strong>sche Bauer (1850) 9 .<br />
In der Zensurbehörde wurde entschieden, ob und mit welchen Auflagen<br />
ein Stück zur Aufführung zugelassen wurde. Zumeist verlangte der<br />
beamtete Zensor Streichungen bzw. Abänderungen «gefährlich» erscheinender<br />
Stellen. Seine Schwierigkeit war, daß durch Minenspiel und Gestik<br />
der Schauspieler manche an und für sich harmlos scheinende Textpassage<br />
eine unerwünschte Nebenbedeutung bekommen konnte. Und schließlich<br />
war noch mit der durch <strong>di</strong>e Zensur mitverursachten Deutungssucht des<br />
Publikums zu rechnen, das auch dort Anspielungen vermutete, wo wirklich<br />
keine verborgen waren. Nach der Bewilligung eines Stückes wurde<br />
<strong>di</strong>eses vom Zensurbeamten approbiert und in einer Weise gesiegelt, daß<br />
keine neuen (unzensierten) Seiten in das Manuskript aufgenommen wer-<br />
6 § 1 der Instruktion, in: Karl Glossy: Zur Geschichte der Theater Wiens I (1801–<br />
1820). In: Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft 25 (1915), S. 59.<br />
7 Ernst Stainhauser Ritter von Treuberg: Tagebuch 1835, Wiener Stadt- und Landesbibliothek<br />
– Handschriftensammlung, Ib 188.299. Stainhauser wurde später einer der<br />
engsten Freunde und Mitarbeiter <strong>Nestroy</strong>s.<br />
8 HKA: Stücke 15, S. 307, und HKA: Stücke 16/I, S. 143.<br />
9 HKA: Stücke 10, S. 177-189; Stücke 16/II, S. 144-148; Stücke 28/I, S. 306-313.