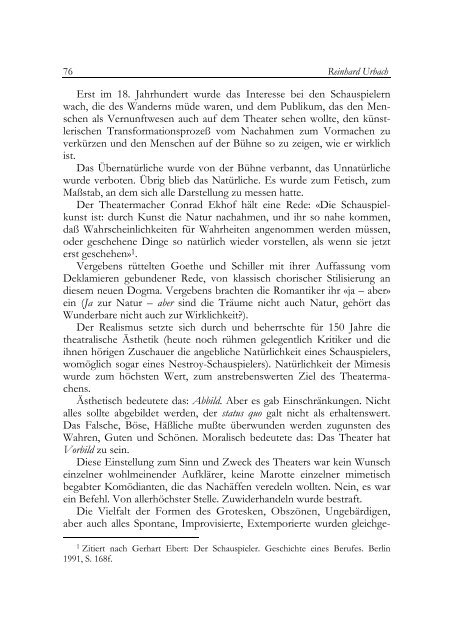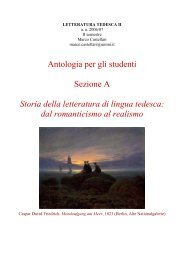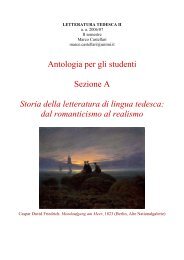Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
76<br />
Reinhard Urbach<br />
Erst im 18. Jahrhundert wurde das Interesse bei den Schauspielern<br />
wach, <strong>di</strong>e des Wanderns müde waren, und dem Publikum, das den Menschen<br />
als Vernunftwesen auch auf dem Theater sehen wollte, den künstlerischen<br />
Transformationsprozeß vom Nachahmen zum Vormachen zu<br />
verkürzen und den Menschen auf der Bühne so zu zeigen, wie er wirklich<br />
ist.<br />
Das Übernatürliche wurde von der Bühne verbannt, das Unnatürliche<br />
wurde verboten. Übrig blieb das Natürliche. Es wurde zum Fetisch, zum<br />
Maßstab, an dem sich alle Darstellung zu messen hatte.<br />
Der Theatermacher Conrad Ekhof hält eine Rede: «Die Schauspielkunst<br />
ist: durch Kunst <strong>di</strong>e Natur nachahmen, und ihr so nahe kommen,<br />
daß Wahrscheinlichkeiten für Wahrheiten angenommen werden müssen,<br />
oder geschehene Dinge so natürlich wieder vorstellen, als wenn sie jetzt<br />
erst geschehen» 1 .<br />
Vergebens rüttelten Goethe und Schiller mit ihrer Auffassung vom<br />
Deklamieren gebundener Rede, von klassisch chorischer Stilisierung an<br />
<strong>di</strong>esem neuen Dogma. Vergebens brachten <strong>di</strong>e Romantiker ihr «ja – aber»<br />
ein (Ja zur Natur – aber sind <strong>di</strong>e Träume nicht auch Natur, gehört das<br />
Wunderbare nicht auch zur Wirklichkeit?).<br />
Der Realismus setzte sich durch und beherrschte für 150 Jahre <strong>di</strong>e<br />
theatralische Ästhetik (heute noch rühmen gelegentlich Kritiker und <strong>di</strong>e<br />
ihnen hörigen Zuschauer <strong>di</strong>e angebliche Natürlichkeit eines Schauspielers,<br />
womöglich sogar eines <strong>Nestroy</strong>-Schauspielers). Natürlichkeit der Mimesis<br />
wurde zum höchsten Wert, zum anstrebenswerten Ziel des Theatermachens.<br />
Ästhetisch bedeutete das: Abbild. Aber es gab Einschränkungen. Nicht<br />
alles sollte abgebildet werden, der status quo galt nicht als erhaltenswert.<br />
Das Falsche, Böse, Häßliche mußte überwunden werden zugunsten des<br />
Wahren, Guten und Schönen. Moralisch bedeutete das: Das Theater hat<br />
Vorbild zu sein.<br />
Diese Einstellung zum Sinn und Zweck des Theaters war kein Wunsch<br />
einzelner wohlmeinender Aufklärer, keine Marotte einzelner mimetisch<br />
begabter Komö<strong>di</strong>anten, <strong>di</strong>e das Nachäffen veredeln wollten. Nein, es war<br />
ein Befehl. Von allerhöchster Stelle. Zuwiderhandeln wurde bestraft.<br />
Die Vielfalt der Formen des Grotesken, Obszönen, Ungebär<strong>di</strong>gen,<br />
aber auch alles Spontane, Improvisierte, Extemporierte wurden gleichge-<br />
1 Zitiert nach Gerhart Ebert: Der Schauspieler. Geschichte eines Berufes. Berlin<br />
1991, S. 168f.