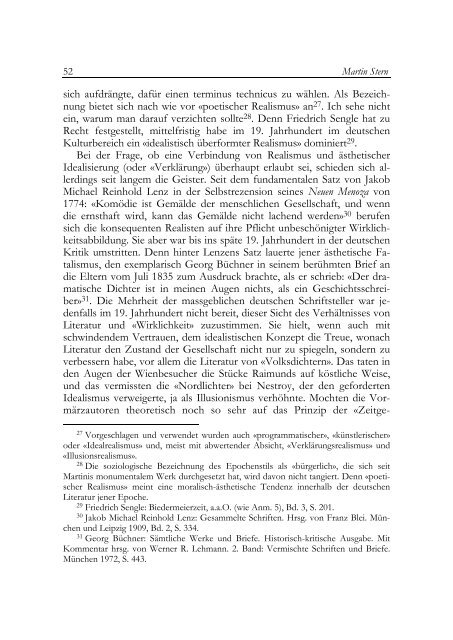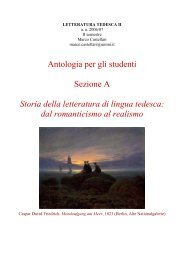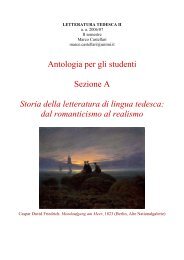Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Johann Nepomuk Nestroy Tradizione e trasgressione a cura di ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
52<br />
Martin Stern<br />
sich aufdrängte, dafür einen terminus technicus zu wählen. Als Bezeichnung<br />
bietet sich nach wie vor «poetischer Realismus» an 27 . Ich sehe nicht<br />
ein, warum man darauf verzichten sollte 28 . Denn Friedrich Sengle hat zu<br />
Recht festgestellt, mittelfristig habe im 19. Jahrhundert im deutschen<br />
Kulturbereich ein «idealistisch überformter Realismus» dominiert 29 .<br />
Bei der Frage, ob eine Verbindung von Realismus und ästhetischer<br />
Idealisierung (oder «Verklärung») überhaupt erlaubt sei, schieden sich aller<strong>di</strong>ngs<br />
seit langem <strong>di</strong>e Geister. Seit dem fundamentalen Satz von Jakob<br />
Michael Reinhold Lenz in der Selbstrezension seines Neuen Menoza von<br />
1774: «Komö<strong>di</strong>e ist Gemälde der menschlichen Gesellschaft, und wenn<br />
<strong>di</strong>e ernsthaft wird, kann das Gemälde nicht lachend werden» 30 berufen<br />
sich <strong>di</strong>e konsequenten Realisten auf ihre Pflicht unbeschönigter Wirklichkeitsabbildung.<br />
Sie aber war bis ins späte 19. Jahrhundert in der deutschen<br />
Kritik umstritten. Denn hinter Lenzens Satz lauerte jener ästhetische Fatalismus,<br />
den exemplarisch Georg Büchner in seinem berühmten Brief an<br />
<strong>di</strong>e Eltern vom Juli 1835 zum Ausdruck brachte, als er schrieb: «Der dramatische<br />
Dichter ist in meinen Augen nichts, als ein Geschichtsschreiber»<br />
31 . Die Mehrheit der massgeblichen deutschen Schriftsteller war jedenfalls<br />
im 19. Jahrhundert nicht bereit, <strong>di</strong>eser Sicht des Verhältnisses von<br />
Literatur und «Wirklichkeit» zuzustimmen. Sie hielt, wenn auch mit<br />
schwindendem Vertrauen, dem idealistischen Konzept <strong>di</strong>e Treue, wonach<br />
Literatur den Zustand der Gesellschaft nicht nur zu spiegeln, sondern zu<br />
verbessern habe, vor allem <strong>di</strong>e Literatur von «Volks<strong>di</strong>chtern». Das taten in<br />
den Augen der Wienbesucher <strong>di</strong>e Stücke Raimunds auf köstliche Weise,<br />
und das vermissten <strong>di</strong>e «Nordlichter» bei <strong>Nestroy</strong>, der den geforderten<br />
Idealismus verweigerte, ja als Illusionismus verhöhnte. Mochten <strong>di</strong>e Vormärzautoren<br />
theoretisch noch so sehr auf das Prinzip der «Zeitge-<br />
27 Vorgeschlagen und verwendet wurden auch «programmatischer», «künstlerischer»<br />
oder «Idealrealismus» und, meist mit abwertender Absicht, «Verklärungsrealismus» und<br />
«Illusionsrealismus».<br />
28 Die soziologische Bezeichnung des Epochenstils als «bürgerlich», <strong>di</strong>e sich seit<br />
Martinis monumentalem Werk durchgesetzt hat, wird davon nicht tangiert. Denn «poetischer<br />
Realismus» meint eine moralisch-ästhetische Tendenz innerhalb der deutschen<br />
Literatur jener Epoche.<br />
29 Friedrich Sengle: Biedermeierzeit, a.a.O. (wie Anm. 5), Bd. 3, S. 201.<br />
30 Jakob Michael Reinhold Lenz: Gesammelte Schriften. Hrsg. von Franz Blei. München<br />
und Leipzig 1909, Bd. 2, S. 334.<br />
31 Georg Büchner: Sämtliche Werke und Briefe. Historisch-kritische Ausgabe. Mit<br />
Kommentar hrsg. von Werner R. Lehmann. 2. Band: Vermischte Schriften und Briefe.<br />
München 1972, S. 443.