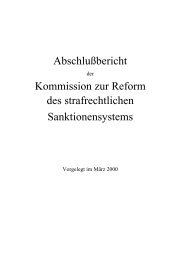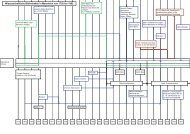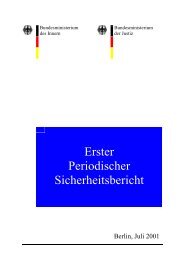Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
PSB Seite 243<br />
rungsverbrechen im Zusammenhang mit kaufmännisch organisierter Beuteverwertung im Großmaßstab<br />
und auf internationaler Ebene (...)." 811<br />
Eine neue Bestandsaufnahme wurde im Kriminalistischen Institut des Bundeskriminalamts Ende 1985<br />
gestartet. Es handelte sich um eine Expertenbefragung von in der Bekämpfung von organisierter Kriminalität<br />
erfahrenen kriminalpolizeilichen Ermittlungsbeamten des Bundes und der Länder. Diese konnten<br />
das in der sonstigen polizeilichen Praxis seit den siebziger Jahren sich verstärkende Bild von der Etablierung<br />
festgefügter, eigenständiger krimineller Organisationen aus der eigenen Sachbearbeitungserfahrung<br />
heraus nicht bestätigen. Aus dem täterorientierten Ermittlungsansatz der spezialisierten OK-Dienststellen<br />
heraus ergab sich demgegenüber sehr klar die wichtige Funktion von Außenbeziehungen zu anderen Tätergruppen.<br />
In der Quintessenz bedeutet dies die Existenz von zwei unterschiedlichen Strukturformen<br />
organisierter Kriminalität. Auf der einen Seite wenige eigenständige Gruppierungen vor allem von ausländischen<br />
Tätern, die ein strukturiertes und von engem Zusammengehörigkeitsgefühl getragenes "Täterreservoir"<br />
bildeten. Auf der anderen Seite viele Straftäterverflechtungen, d. h. ein eher flexibles System<br />
oder auch lockeres Gefüge von erfahrenen Straftätern, die sich bei Bedarf von Fall zu Fall in unterschiedlicher<br />
Zusammensetzung zu Zweckgemeinschaften zusammenschlossen. 812 Im Vergleich mit den rund 15<br />
Jahre zurückliegenden Europaratsergebnissen folgt aus diesen Befunden kein qualitativer Sprung in der<br />
Entwicklung der Kriminalitätslage.<br />
Bei einer fast zeitgleich in Berlin durchgeführten Studie der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege<br />
Berlin ergaben sich ebenfalls (noch) keine überzeugenden Belege für die Existenz einer monopolistischen,<br />
strikt hierarchisch gegliederten Organisierten Kriminalität. Hier konnte anhand der Angaben<br />
der Ermittler aber immerhin aufgezeigt werden, dass es Straftätergruppierungen unterschiedlicher Größe<br />
(bis maximal ca. 50 Personen) gab, die im Kern stabil waren, feste Strukturen ohne ausgeprägte Hierarchie<br />
aufwiesen und sich einer ausgeprägten Arbeitsteilung befleißigten. Untereinander bildeten diese<br />
Gruppierungen kein geschlossenes, durch formelle Elemente charakterisiertes System. Vielmehr standen<br />
sie in lockeren informellen Beziehungen zueinander, woraus ein Netzwerk von Kenntnissen und Bekanntschaften<br />
entstanden war. 813 Dieses Netzwerk wurde im Wesentlichen zur Informationsweitergabe und zur<br />
gezielten Informationsbeschaffung im Bedarfsfall genutzt. Mit dem Terminus Netzstrukturkriminalität<br />
pointieren die Autoren die Abgrenzung der Befunde von dem Bild übergreifender Verbrechersyndikate.<br />
In der 1990 veröffentlichten Studie des Bundeskriminalamtes wurden im Wege des so genannten Delphi-<br />
Verfahrens erfahrene Personen aus den Bereichen Polizei, Justiz, Wirtschaft und Medien um eine aktuelle<br />
Gefahreneinschätzung gebeten, einschließlich absehbarer neuer Gefährdungen im Zusammenhang mit<br />
dem sozialen und wirtschaftlichen Umbruch in Mittel- und Osteuropa. Die überwiegende Meinung ging<br />
(auch) hier dahin, dass es durchaus kriminelle Strukturen gebe, jedoch in der überwiegenden Zahl in der<br />
Form von dynamisch funktionierenden Beziehungsgeflechten zwischen überschaubaren Gruppen, auch<br />
weit über die deutschen Grenzen hinaus, die nicht in formelle Abhängigkeiten eingespannt seien, sondern<br />
nur lockere Bindungen zeigten. 814<br />
In einer in kurzem Abstand danach für das Bundeskriminalamt durchgeführten Untersuchung wurde der<br />
wirtschaftswissenschaftliche Ansatz der Logistik zugrundegelegt, auch um zu überprüfen, ob sich ein<br />
geeignetes Präventionskonzept zum Vorgehen gegen organisierte Kriminalität entwickeln lassen könnte.<br />
In dieser Pilotstudie zur internationalen Kfz-Verschiebung, zur Ausbeutung von Prostitution, zum Menschenhandel<br />
und zum illegalen Glücksspiel kamen die Autoren anhand einer Auswertung der seitherigen<br />
811 Ebenda, S. 296 mit weiteren Details. Zur zeitnahen Diskussion solcher und anderer Befunde vgl. die Tagungsdokumentation<br />
der Tagung des Bundeskriminalamtes vom Herbst 1996 (BUNDESKRIMINALAMT (Hg.), 1997a).<br />
812 Vgl. REBSCHER, E. und W. VAHLENKAMP, 1988, insbesondere S. 13, 24, 29 und 181.<br />
813 Vgl. WESCHKE, E. und K. HEINE-HEIß, 1990, insbesondere S. 7 ff., 29 ff. und 42f.<br />
814 Vgl. DÖRMANN, U., KOCH, K-F., RISCH, H. und W. VAHLENKAMP, 1990, S. 10 ff., 18.