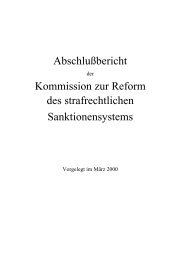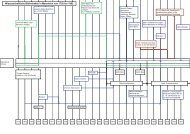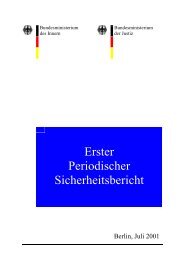Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Innere Sicherheit
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Seite 328<br />
stellungen erworben haben und sich "nur" mit der Situation und den Beschwernissen in der neuen Heimat<br />
mehr oder minder mühsam zu arrangieren lernen müssen, ist dies für die ganz Jungen anders. Sie leben<br />
jedenfalls psychologisch und sozialpsychologisch gesehen, gegebenenfalls aber auch buchstäblich, zwischen<br />
zwei Kulturen, der so genannten Herkunftskultur ihrer Eltern (der Verwandten, Bekannten, Nachbarn,<br />
Brauchtumsgruppen und vielen anderen signifikanten Bezugspersonen und -gruppen mehr) auf der<br />
einen Seite und der so genannten Wirtskultur (der sie umgebenden Gesellschaft mit Straßengruppen<br />
Gleichaltriger, Kindergärten, Schulen, Freizeiteinrichtungen, Vereinen, Ausbildungsstätten und vielen<br />
anderen Institutionen der sog. informellen Sozialisation und sozialen Kontrolle) auf der anderen Seite.<br />
Aus den unterschiedlichen Traditionen dieser Kulturen entstehen für sie voneinander abweichende, mitunter<br />
massiv widerstreitende, Anforderungen bezüglich der "richtigen" Meinungen, Orientierungen und<br />
Verhaltensweisen. In diesem Spannungsfeld müssen sie ihre Identität finden und entwickeln.<br />
Wenn sich die jungen Menschen in der neuen Heimat behaupten und vorankommen wollen, was für die<br />
Mehrheit unter ihnen ohne Abstriche gilt, müssen sie den Kontakt mit der Aufnahmegesellschaft suchen<br />
und sich an deren Werten, Normen und Verhaltensvorgaben orientieren. In allen modernen Staaten und<br />
Gesellschaften sorgt vor allem die Schulpflicht für einen Dauerkontakt. Allein aus diesen (auch) äußerlichen<br />
Kontakten können bereits vermehrte Gelegenheiten zu Auffälligkeiten und Konflikten entstehen.<br />
Sofern die jungen Menschen ansonsten mit den divergierenden kulturellen Anforderungen ihrer Herkunftskultur<br />
und der Kultur des Aufnahmelandes zurechtkommen, oder die Spannungen sogar in besonders<br />
kreativen Lebensgestaltungen auflösen, hält sich das Ausmaß von manifesten Auffälligkeiten und<br />
Konflikten in Grenzen. Schwieriger wird es, wenn die jungen Menschen wiederholt auf Vorurteile und<br />
Diskriminierungen stoßen, mit diesen nicht produktiv umgehen können, sondern aus der Balance geraten<br />
und am Ende auf krisenhafte Verschärfungen zusteuern. Daraus kann sich ein ausgeprägter so genannter<br />
innerer Kulturkonflikt 1035 entwickeln. Ob ihn die jungen Menschen letztlich ohne bleibende Schäden an<br />
der eigenen Persönlichkeitsbildung und biographischen Entwicklung (oder, bildlich gesprochen, mit nur<br />
wenigen Narben) bewältigen oder ob sie in selbstschädigende Zustände oder Verhaltensmuster verfallen<br />
(wie psychosomatische Störungen, Medikamentenabhängigkeit, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch,<br />
Selbstverletzungen, Suizidversuche) oder ob sie die Probleme nach außen wenden und beispielsweise<br />
expressiv aggressive Handlungen gegen andere verüben, hängt im Einzelnen von vielen weiteren Umständen<br />
ab. 1036 Wichtig erscheint generell, wie vor allem die kriminologische Anomietheorie einsichtig<br />
gemacht hat 1037 , dass man solche auf den ersten Blick weit auseinander liegenden "Lösungen" als Ausdruck<br />
bzw. Folge derselben Grundkonstellation sehen kann. Je traditioneller die überkommenen bzw. in<br />
der frühen Sozialisation schon eingeübten Geschlechtsrollen in einer Gruppe ausgeprägt sind, desto höher<br />
wird bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Anteil der nach außen gerichteten expressiven<br />
Gewalt ausfallen. 1038<br />
Gerade bei den jungen männlichen Spätaussiedlern der letzten Einwanderungswelle scheint der Keim des<br />
Problems in Teilen schon dadurch erzeugt worden zu sein, dass viele von ihnen ohne eigenen Wunsch<br />
1035<br />
Im Gegensatz zum lediglich äußeren bzw. äußerlichen Kulturkonflikt, der auch ältere Zuwanderer betreffen kann, wenn<br />
Normen, die man aus der alten Heimat sozusagen "mitgebracht" hat, zu Verhaltensweisen führen, die mit den Normen in der<br />
neuen Umgebung nicht übereinstimmen. Das schließt auch Rechtsnormen mit ein. Im Rückzug auf die eigene Gruppe, in Kontaktvermeidung<br />
mit der Aufnahmegesellschaft, im Extremfall Ghettobildung liegt eine, freilich negativ betonte, von mehreren<br />
Lösungsstrategien zur Reduktion der äußeren Konflikte. Kriminologisch wurde die Problematik erstmals ausführlich von SELLIN,<br />
T., 1938, entwickelt.<br />
1036<br />
Zu den Problemen ihrer Erfassung und Gewichtung bei konkreten Strafverfahren vgl. die bei BILSKY, W. (Hg.), 2000, versammelten<br />
Beiträge.<br />
1037<br />
Besonders in der von Robert K. MERTON entwickelten Variante. Vgl. dazu spezifisch LUFF, J., 2000, S. 20 ff. mit weiteren<br />
Nachweisen; zur Grundlegung der Anomietheorie siehe zuletzt ORTMANN, R., 1999, S. 419 ff.<br />
1038<br />
Am Beispiel junger Türken zeigen beispielsweise HALM, D., 2000, S. 286 ff. und TOBRAK, A., 2000, S. 364 ff. anschaulich<br />
auf, dass manifeste Gewalt, die unter Umständen tatsächlich gehäuft auftritt, sich nicht auf "Eigenschaften" gründet, sondern aus<br />
soziologisch und sozialpsychologisch nachvollziehbaren Strukturen, sozialen Traditionen und Dynamiken der Abgrenzung<br />
heraus zu verstehen ist.<br />
PSB